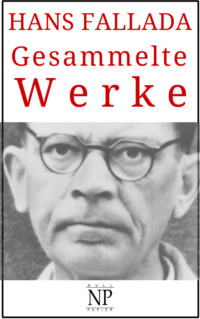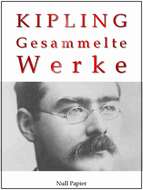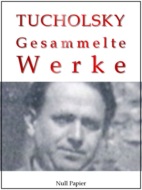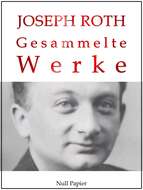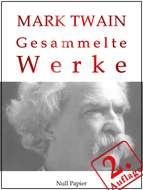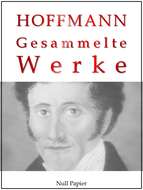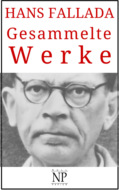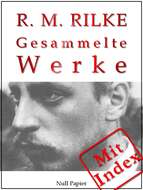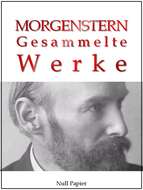Читать книгу: «Hans Fallada – Gesammelte Werke», страница 3
4. Trudel Baumann verrät ein Geheimnis
So leicht Otto Quangel auch in die Fabrik gekommen war, so schwer war es zu erreichen, dass die Trudel Baumann zu ihm herausgerufen wurde. Sie arbeiteten hier nämlich – übrigens genau wie in Quangels Fabrik – nicht nur im Akkord, sondern jede Arbeitsstube musste auch ein bestimmtes Pensum schaffen, da kam es oft auf jede Minute an.
Aber schließlich erreicht Quangel doch sein Ziel, schließlich ist der andere genauso ein Werkmeister wie er selbst. Man kann einem Kollegen so was schlecht abschlagen, besonders wenn grade der Sohn gefallen ist. Das hat Quangel nun doch sagen müssen, bloß um die Trudel zu sehen zu kriegen. Daraus folgt, dass er’s ihr auch selber sagen muss, gegen die Bitte der Frau, sonst würde es ihr der Werkmeister erzählen. Hoffentlich gibt’s kein Geschrei und vor allem keine Umfallerei. Eigentlich ein Wunder, wie die Anna sich gehalten hat – nun, die Trudel steht auch auf festen Beinen.
Da kommt sie endlich, und Quangel, der nie ein anderes Verhältnis als das zu seiner Frau gehabt hat, muss sich gestehen, dass sie reizend aussieht mit ihrem Wuschelkopf dunkler, plustriger Haare, dem runden Gesicht, dem keine Fabrikarbeit die frischen Farben hat nehmen können, mit den lachenden Augen und der hohen Brust. Selbst jetzt, wo sie wegen der Arbeit lange blaue Hosen trägt und einen alten, vielfach gestopften Jumper, der voll von Garnresten hängt, selbst jetzt sieht sie reizend aus. Das Schönste an ihr ist aber vielleicht ihre Art, sich zu bewegen, alles sprüht von Leben, jeden Schritt scheint sie gerne zu tun: sie quillt über vor Lebensfreude.
Ein Wunder eigentlich, denkt Otto Quangel flüchtig, dass solch eine Trantute wie der Otto, so ein von der Mutter verpimpeltes Söhnchen, sich solch ein Prachtmädel einhandeln konnte. Aber, verbessert er sich gleich, was weiß ich denn vom Otto? Ich habe ihn ja eigentlich nie richtig gesehen. Er muss ganz anders gewesen sein, wie ich gedacht habe. Und mit den Radios hat er wirklich was losgehabt, die Meister haben sich doch alle um ihn gerissen.
»Tag, Trudel«, sagt er und gibt ihr seine Hand, in die rasch und kräftig ihre warme, mollige schlüpft.
»Tag, Vater«, antwortet sie. »Nun, was ist los bei euch zu Haus? Hat Muttchen mal wieder Sehnsucht nach mir, oder hat Otto geschrieben? Ich will sehen, dass ich möglichst bald mal bei euch reinschaue.«
»Es muss schon heute Abend sein, Trudel«, sagte Otto Quangel. »Die Sache ist nämlich die …«
Aber er spricht seinen Satz nicht zu Ende. Trudel ist in ihrer raschen Art schon in die Tasche der blauen Hose gefahren und hat einen Taschenkalender hervorgeholt, in dem sie jetzt blättert. Sie hört nur mit halbem Ohr zu, nicht der richtige Augenblick, um ihr so was zu sagen. So wartet denn Quangel geduldig, bis sie gefunden hat, was sie sucht.
Diese Zusammenkunft der beiden findet in einem langen, zugigen Gange statt, dessen getünchte Wände ganz vollgepflastert mit Plakaten sind. Unwillkürlich fällt Quangels Blick auf ein Plakat, das schräg hinter Trudel hängt. Er liest ein paar Worte, die fettgedruckte Überschrift: »Im Namen des deutschen Volkes«, dann drei Namen und: »wurden wegen Landes- und Hochverrates zum Tode durch den Strang verurteilt. Die Hinrichtung wurde heute Morgen in der Strafanstalt Plötzensee vollzogen.«
Ganz unwillkürlich hat er mit beiden Händen die Trudel gefasst und sie so weit zur Seite gezogen, dass sie nicht mehr vor dem Plakat steht. »Wieso?«, hat sie erst überrascht gefragt, dann sind ihre Augen dem Blick der seinen gefolgt, und sie liest auch das Plakat. Sie gibt einen Laut von sich, der alles bedeuten kann: Protest gegen das Gelesene, Ablehnung von Quangels Tun, Gleichgültigkeit, aber jedenfalls kehrt sie nicht an den alten Platz zurück. Sie sagt und steckt den Kalender wieder in die Tasche: »Heute Abend geht’s unmöglich, Vater, aber morgen werde ich gegen acht bei euch sein.«
»Es muss aber heute Abend gehen, Trudel!«, widerspricht Otto Quangel. »Es ist nämlich Nachricht gekommen über Otto.« Sein Blick ist noch schärfer geworden, er sieht, wie das Lachen aus ihrem Blick schwindet. »Der Otto ist nämlich gefallen, Trudel.«
Es ist seltsam, derselbe Laut, den Otto Quangel bei dieser Nachricht von sich gegeben hat, kommt jetzt aus Trudels Brust, ein tiefes »Oh …!«. Einen Augenblick sieht sie den Mann mit schwimmenden Augen an, ihre Lippen zittern; dann wendet sie das Gesicht zur Wand, sie lehnt ihre Stirn gegen sie. Sie weint, aber sie weint lautlos. Quangel sieht wohl ihre Schultern beben, aber er hört keinen Laut.
Tapferes Mädel!, denkt er. Wie sie doch am Otto gehangen hat! In seiner Art ist er auch tapfer gewesen, hat nie mit diesen Scheißkerlen mitgemacht, hat sich nicht von der HJ12 gegen seine Eltern aufhetzen lassen, war immer gegen das Soldatenspielen und gegen den Krieg. Dieser verdammte Krieg!
Er hält inne, erschrocken über das, was er da eben gedacht hat. Verändert er sich nun auch schon? Das war ja eben beinahe so etwas wie Annas ›Du und dein Hitler!‹.
Dann sieht er, dass Trudel mit der Stirne nun grade gegen jenes Plakat lehnt, von dem er sie eben erst fortgezogen hat. Über ihrem Kopf steht in Fettschrift zu lesen: »Im Namen des deutschen Volkes«, ihre Stirn verdeckt die Namen der drei Gehängten …
Und wie eine Vision steigt es vor ihm auf, dass eines Tages solch ein Plakat mit den Namen von ihm und Anna und Trudel an den Wänden kleben könnte. Er schüttelt unmutig den Kopf. Er ist ein einfacher Handarbeiter, der nur seine Ruhe haben und nichts von Politik wissen will, Anna kümmert sich nur um ihren Haushalt, und solch ein bildhübsches Mädel wie die Trudel dort wird bald einen neuen Freund gefunden haben …
Aber die Vision ist hartnäckig, sie bleibt. Unsere Namen an der Wand, denkt er, nun völlig verwirrt. Und warum eigentlich nicht? Am Galgen hängen ist auch nicht schlimmer, als von einer Granate zerrissen zu werden oder am Bauchschuss krepieren! Das alles ist nicht wichtig. Was allein wichtig ist, das ist: Ich muss rauskriegen, was das mit dem Hitler ist. Erst schien doch alles gut zu sein, und nun plötzlich ist alles schlimm. Plötzlich sehe ich nur Unterdrückung und Hass und Zwang und Leid, so viel Leid … Ein paar Tausend, hat dieser feige Spitzel, der Barkhausen, gesagt. Als wenn es auf die Zahl ankäme! Wenn nur ein einziger Mensch ungerecht leidet, und ich kann es ändern, und ich tue es nicht, bloß weil ich feige bin und meine Ruhe zu sehr liebe, dann …
Hier wagt er nicht weiterzudenken. Er hat Angst, richtig Angst davor, wohin ihn ein solcher zu Ende gedachter Gedanke führen kann. Sein ganzes Leben müsste er dann vielleicht ändern!
Stattdessen starrt er wieder auf das Mädchen, über dessen Kopf »Im Namen des deutschen Volkes« zu lesen ist. Nicht grade gegen dieses Plakat gelehnt, sollte sie weinen. Er kann der Versuchung nicht widerstehen, er dreht ihre Schulter von der Wand fort und sagt, so sanft er kann: »Komm, Trudel, nicht gegen dieses Plakat …«
Einen Augenblick starrt sie die gedruckten Worte verständnislos an. Ihr Auge ist schon wieder trocken, ihre Schultern beben nicht mehr. Dann kommt wieder Leben in ihren Blick, nicht das alte, frohe Leuchten, mit dem sie diesen Gang betreten, sondern etwas dunkel Glühendes. Sie legt ihre Hand fest und doch zärtlich an die Stelle, wo das Wort »gehängt« steht. »Ich werd nie vergessen, Vater«, sagt sie, »dass ich grade vor so einem Plakat wegen Otto geheult habe. Vielleicht – ich möcht’s nicht –, aber vielleicht wird auch mal mein Name auf so einem Wisch stehen.«
Sie starrt ihn an. Er hat das Gefühl, sie weiß nicht genau, was sie spricht. »Mädel!«, ruft er erschrocken. »Besinn dich! Wie sollst du und solch ein Plakat … Du bist jung, das ganze Leben liegt vor dir. Du wirst wieder lachen, du wirst Kinder haben …«
Sie schüttelt trotzig den Kopf. »Ich krieg keine Kinder, solange ich nicht bestimmt weiß, sie werden mir nicht totgeschossen. Solange irgend so ein General sagen kann: Marschier und krepier! Vater«, fährt sie fort und fasst jetzt seine Hand fest in die ihre, »Vater, kannst du denn wirklich wie bisher weiterleben, jetzt, wo sie dir deinen Otto totgeschossen haben?«
Sie sieht ihn eindringlich an, und wieder wehrt er sich gegen das Fremde, das in ihn eindringt. »Die Franzosen«, murmelt er.
»Die Franzosen!«, ruft sie empört. »Redest du dich auf so was raus? Wer hat denn die Franzosen überfallen? Na wer, Vater? Sag doch!«
»Aber was können wir denn tun?«, wehrt sich Otto Quangel verzweifelt gegen dieses Drängen. »Wir sind nur ein paar, und all die Millionen sind für ihn, und jetzt nach diesem Siege gegen Frankreich erst recht. Gar nichts können wir tun!«
»Viel können wir tun!«, flüstert sie eifrig. »Wir können die Maschinen in Unordnung bringen, wir können schlecht und langsam arbeiten, wir können deren Plakate abreißen und andere ankleben, in denen wir den Leuten sagen, wie sie belogen und betrogen werden.« Sie flüstert noch leiser: »Aber die Hauptsache ist, dass wir anders sind als die, dass wir uns nie dazu kriegen lassen, so zu sein, so zu denken wie die. Wir werden eben keine Nazis, und wenn die die ganze Welt besiegen!«
»Und was erreichen wir damit, Trudel?«, fragt Otto Quangel leise. »Ich sehe nicht, was wir damit erreichen.«
»Vater«, antwortet sie. »Ich hab’s im Anfang auch nicht verstanden, und ganz richtig versteh ich’s noch immer nicht. Aber, weißt du, wir haben hier so im Geheimen eine kommunistische Zelle im Betrieb gebildet, ganz klein erst, drei Männer und ich. Da ist einer bei uns, der hat’s mir zu erklären versucht. Wir sind, hat er gesagt, wie der gute Same in einem Acker voll Unkraut. Wenn der gute Same nicht wäre, stünde der ganze Acker voller Unkraut. Und der gute Same kann sich ausbreiten …«
Sie hält inne, als sei sie über etwas zutiefst erschrocken.
»Was ist, Trudel?«, fragt er. »Das mit dem guten Samen, das ist kein schlechter Gedanke. Ich werde darüber nachdenken, ich habe so viel nachzudenken in nächster Zeit.«
Aber sie sagt voll Scham und Reue: »Nun habe ich das mit der Zelle doch ausgeplappert, und ich habe doch heilig geschworen, es keinem einzigen Menschen zu verraten!«
»Darüber mach dir keine Gedanken, Trudel«, sagt Otto Quangel, und seine Ruhe überträgt sich unwillkürlich auf das gequälte Ding. »Bei dem Otto Quangel geht so was zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Ich weiß von nichts mehr.« Mit einer grimmigen Entschlossenheit starrt er jetzt auf das Plakat. »Da könnte die ganze Gestapo kommen, ich weiß eben von nichts mehr. Und«, setzt er hinzu, »und wenn du willst, und es macht dich ruhiger, so kennst du uns eben von dieser Stunde an nicht mehr. Du brauchst auch heute Abend nicht mehr zu Anna zu kommen, ich mach’s ihr schon irgendwie mundgerecht, ohne ihr etwas zu sagen.«
»Nein«, antwortet sie darauf, sicher geworden. »Nein. Zur Mutter gehe ich heute Abend noch. Aber ich werde es den anderen sagen müssen, dass ich mich verplappert habe, und vielleicht wird dich einer vernehmen, um zu sehen, ob du auch zuverlässig bist.«
»Die sollen mir nur kommen!«, sagt Otto Quangel drohend. »Ich weiß von nichts. Ich hab mit Politik noch nie was zu tun gehabt, mein ganzes Leben lang nicht. Auf Wiedersehen, Trudel. Ich werde dich wohl heute nicht mehr sehen, vor zwölfe komme ich fast nie von der Arbeit zurück.«
Sie gibt ihm die Hand und geht dann den Gang zurück, in das Innere der Fabrik hinein. Sie steckt nicht mehr so voll von sprühendem Leben, aber sie ist immer noch voller Kraft. Gutes Mädel!, denkt Quangel. Tapferer Kerl!
Dann steht Quangel allein auf dem Gang mit seinen Plakaten, die in dem ewigen Zug leise rascheln. Er schickt sich an zu gehen. Aber vorher tut er noch etwas, das ihn selbst überrascht: Er nickt dem Plakat, an dem Trudel weinte, zu – mit einer grimmigen Entschlossenheit.
Im nächsten Augenblick schämt er sich seines Tuns. Das ist ja blöde Fatzkerei! Dann macht er, dass er nach Hause kommt. Es ist die allerhöchste Zeit, er muss sogar eine Elektrische nehmen, was seinem Sparsinn, der manchmal fast an Geiz grenzt, verhasst ist.
5. Enno Kluges Heimkehr
Um zwei Uhr nachmittags war die Briefträgerin Eva Kluge mit ihrem Bestellgang fertig geworden. Bis gegen vier Uhr hatte sie noch mit der Abrechnung ihrer Zahlkarten und Anweisungen zu tun gehabt: War sie sehr müde, verwirrten sich ihr die Zahlen, und sie verrechnete sich immer wieder. Mit brennenden Füßen und einer schmerzenden Öde im Kopf machte sie sich auf den Heimweg; sie mochte gar nicht daran denken, was sie noch alles zu tun hatte, bis sie endlich ins Bett gehen konnte. Auf dem Heimweg erledigte sie noch ihre Besorgungen auf Karten; beim Fleischer musste sie ziemlich lange anstehen, und so war es fast sechs Uhr geworden, als sie langsam die Stufen ihrer Wohnung am Friedrichshain emporstieg.
Auf der Treppenstufe vor ihrer Tür stand ein kleiner Mann in hellem Mantel und mit Sportmütze auf. Er hatte ein farbloses Gesicht ohne allen Ausdruck, die Lider waren ein wenig entzündet, die Augen blass, solch ein Gesicht, das man sofort wieder vergisst.
»Du, Enno?«, rief sie erschrocken und nahm die Wohnungsschlüssel unwillkürlich fester in die Hand. »Was willst du denn bei mir? Ich habe kein Geld und auch kein Essen, und in die Wohnung lasse ich dich auch nicht!«
Der kleine Mann machte eine beruhigende Bewegung. »Warum denn gleich so aufgeregt, Eva? Wieso denn gleich so bösartig? Ich will dir doch bloß mal guten Tag sagen, Eva. Guten Tag, Eva!«
»Guten Tag, Enno!«, sagte sie, aber nur widerwillig, denn sie kannte ihren Mann seit vielen Jahren. Sie wartete eine Weile, dann lachte sie kurz und böse auf. »Jetzt haben wir uns guten Tag gesagt, wie du wolltest, Enno, und du kannst gehen. Aber wie ich seh, gehst du nicht, was willst du also wirklich?«
»Siehste, Evchen«, sagte er, ihr immer gut zuredend. »Du bist ’ne vernünftige Frau, und mit dir kann man ’n Wort reden …« Er fing an, ihr umständlich auseinanderzusetzen, dass die Krankenkasse nicht mehr länger zahlte, weil er seine sechsundzwanzig Wochen Kranksein rum hatte. Er musste wieder arbeiten gehen, sonst schickten sie ihn zurück zur Wehrmacht, die ihn seiner Fabrik zur Verfügung gestellt hatte, weil er Feinmechaniker war, und die waren knapp. »Die Sache ist nun die und der Umstand der«, schloss er seine Erklärungen, »dass ich die nächsten Tage einen festen Wohnsitz haben muss. Und da habe ich gedacht …«
Sie schüttelte energisch den Kopf. Sie war zum Umsinken müde und sehnte sich danach, in die Wohnung zu kommen, wo so viel Arbeit auf sie wartete. Aber sie ließ ihn nicht ein, ihn nicht, und wenn sie die halbe Nacht hier stehen musste.
Er sagte eilig, aber es klang immer gleich farblos: »Sag noch nicht nein, Evchen, ich bin noch nicht zu Ende mit meinen Worten. Ich schwöre dir, ich will gar nichts von dir, kein Geld, kein Essen. Lass mich bloß auf dem Kanapee schlafen. Ich brauch auch keine Bettwäsche. Du sollst nicht Arbeit von mir haben.«
Wieder schüttelte sie den Kopf. Wenn er bloß aufhören wollte mit reden, er sollte doch wissen, dass sie ihm nicht ein Wort glaubte. Er hatte noch nie gehalten, was er versprochen hatte.
Sie fragte: »Warum machst du das nicht bei einer von deinen Freundinnen ab? Die sind dir doch sonst gut genug für so was!«
Er schüttelte den Kopf: »Mit den Weibern bin ich durch, Evchen, mit denen befass ich mich nicht mehr, mit denen hat’s mir gereicht. Wenn ich alles bedenke, du warst doch immer die Beste von allen, Evchen. Gute Jahre haben wir gehabt, damals, als die Jungen noch klein waren.«
Unwillkürlich hatte sich ihr Gesicht bei der Erinnerung an ihre ersten Ehejahre aufgehellt. Die waren wirklich gut gewesen, damals, als er noch als Feinmechaniker arbeitete und jede Woche seine sechzig Mark nach Haus brachte und von Arbeitsscheu nichts wusste.
Enno Kluge sah sofort seinen Vorteil. »Siehste, Evchen, ein bisschen hast du mich doch noch gerne, und darum lässt du mich auch auf dem Kanapee schlafen. Ich versprech dir, ich mach’s ganz schnell ab mit dem Arbeiten, mir liegt doch auch nichts an dem Kohl. Bloß so lange, dass ich wieder Krankengeld kriege und nicht zu den Preußen muss. In zehn Tagen schaff ich’s, dass sie mich wieder krankschreiben!«
Er machte eine Pause und sah sie abwartend an. Diesmal schüttelte sie nicht den Kopf, aber ihr Gesicht sah undurchdringlich aus. So fuhr er fort: »Ich will’s diesmal nicht mit Magenblutungen machen, da geben sie einem nichts zu fressen in den Krankenhäusern. Ich reise diesmal auf Gallenkoliken. Da können sie einem auch nichts nachweisen, bloß mal röntgen, und man muss keine Steine haben für die Koliken. Man kann bloß. Ich habe mir alles genau erklären lassen. Das klappt schon. Bloß dass ich erst diese zehn Tage arbeiten muss.«
Sie antwortete wieder mit keinem Wort, und er fuhr fort, denn er glaubte daran, dass man den Leuten ein Loch in den Bauch reden kann, dass sie schließlich doch nachgeben, wenn man nur beharrlich genug ist. »Ich habe auch die Adresse von ’nem jüdischen Arzt in der Frankfurter Allee, der schreibt jeden krank, wenn man will, bloß dass er keine Schwierigkeiten hat mit den Leuten. Mit dem schaff ich’s: in zehn Tagen bin ich wieder im Krankenhaus, und du bist mich los, Evchen!«
Sie sagte, müde all dieses Geschwätzes: »Und wenn du bis Mitternacht hier stehst und redest, ich nehme dich doch nicht wieder auf, Enno. Ich tu’s nie wieder, du kannst sagen, was du willst, und du kannst tun, was du willst. Ich lass mir nicht wieder alles kaputtmachen von dir und deiner Arbeitsscheu und deiner Rennwetterei und deinen gemeinen Weibern. Ich hab’s dreimal erlebt und das vierte Mal und noch mal und noch mal, und nun hat’s geschnappt bei mir, nun ist es alle! Ich setze mich hier auf die Treppe, ich bin nämlich müde, seit sechs bin ich auf den Beinen. Wenn du willst, setz dich dazu. Wenn du magst, rede, wenn du nicht magst, halt den Mund, mir ist alles egal. Aber in die Wohnung kommst du mir nicht!«
Sie hatte sich wirklich auf die Treppenstufe gesetzt, auf die gleiche Stufe, die vorher sein Warteplatz gewesen war. Und ihre Worte hatten so entschlossen geklungen, dass er fühlte, diesmal half auch alles Reden nichts. So rückte er denn seine Jockeymütze ein wenig schief und sagte: »Na denn, Evchen, wenn du durchaus nicht willst, wenn du mir nicht mal so ’nen kleinen Gefallen tun willst, wo du weißt, dein Mann ist in Not, mit dem du fünf Kinder gehabt hast, und drei liegen auf dem Kirchhof, und die zwei Jungen kämpfen für Führer und Volk …« Er brach ab, er hatte ganz maschinenmäßig so vor sich hin geredet, weil er das Immerweiterreden aus den Kneipen gewohnt war, obwohl er doch begriffen hatte, hier war jedes Reden zwecklos. »Also, ich geh denn jetzt, Evchen. Und dass du’s weißt, ich nehm dir nichts übel, das weißt du, ich mag sein, wie ich will, übelnehmen tu ich nichts.«
»Weil dir alles gleichgültig ist bis auf deine Rennwetterei«, antwortete sie nun doch. »Weil dich sonst nichts auf der Welt interessiert, weil du nichts und keinen gernhaben kannst, nicht einmal dich selbst, Enno.« Aber sie brach sofort wieder ab, es war so nutzlos, mit diesem Mann zu sprechen. Sie wartete eine Weile, dann sagte sie: »Aber ich denke, du wolltest gehen, Enno?«
»Jetzt geh ich, Evchen«, sagte er ganz überraschend. »Mach’s gut. Ich nehm dir nichts übel. Heil Hitler, Evchen!«
»Heil Hitler!«, antwortete sie ganz mechanisch, immer noch fest davon überzeugt, dass dieses Abschiednehmen nur eine Finte von ihm war, bloß die Einleitung zu neuem, endlosem Gerede. Aber zu ihrer grenzenlosen Überraschung sagte er wirklich nichts mehr, sondern fing an, die Treppe hinabzusteigen.
Eine, zwei Minuten saß sie noch wie betäubt auf der Stufe, sie konnte noch nicht an ihren Sieg glauben. Dann sprang sie auf und lauschte ins Treppenhaus. Sie hörte deutlich seinen Schritt auf der untersten Treppe, er hatte sich nicht versteckt, er ging wirklich! Nun klappte die Haustür. Mit zitternder Hand schloss sie die Tür auf; sie war so erregt, dass sie zuerst das Schlüsselloch nicht finden konnte. Als sie drinnen war, legte sie die Kette vor und sank auf einen Küchenstuhl. Die Glieder hingen ihr runter, dieser Kampf eben hatte die letzte Kraft aus ihr gepumpt. Sie hatte kein Mark mehr in den Knochen, jetzt hätte sie einer nur mit einem Finger anstoßen müssen, sie wäre glatt vom Küchenstuhl gerutscht.
Aber allmählich, wie sie dort hockte, kehrten wieder Kraft und Leben in sie zurück. So hatte sie es denn auch einmal geschafft, ihr Wille hatte seine sture Hartnäckigkeit bezwungen. Sie hatte ihr Heim für sich behalten, für sich ganz allein. Er würde da nicht wieder rumsitzen, endlos von seinen Pferden reden und ihr jede Mark und jeden Kanten Brot stehlen, den er nur erwischen konnte.
Sie sprang auf, von neuem Lebensmut erfüllt. Dieses Stückchen Leben war ihr verblieben. Nach dem endlosen Dienst auf der Post brauchte sie diese paar Stunden hier für sich allein. Der Bestellgang fiel ihr schwer, sehr schwer, immer schwerer. Sie hatte schon früher mit dem Unterleib zu tun gehabt, nicht umsonst lagen die drei Jüngsten auf dem Friedhof: alles Frühgeburten. Die Beine wollten auch nicht mehr so. Sie war eben keine Frau für das Erwerbsleben, sie war eigentlich eine richtige Hausfrau. Aber sie hatte verdienen müssen, als der Mann plötzlich aufgehört hatte zu arbeiten. Damals waren die beiden Jungen noch klein gewesen. Sie hatte sie hochgebracht, sie hatte sich dieses Heim geschaffen: Wohnküche und Kammer. Und dabei hatte sie noch den Mann mit durchgeschleppt, wenn er nicht gerade bei einer seiner Geliebten untergekrochen war.
Selbstverständlich hätte sie sich längst von ihm scheiden lassen können, er machte ja gar kein Hehl aus seinen Ehebrüchen. Aber eine Scheidung hätte nichts geändert, ob geschieden oder nicht, Enno hätte sich weiter an sie geklammert. Dem war alles egal, der hatte keinen Funken Ehre im Leibe.
Dass sie ihn ganz aus der Wohnung gesetzt hatte, das war erst geschehen, als die beiden Jungen in den Krieg gezogen waren. Bis dahin hatte sie immer noch geglaubt, wenigstens den Schein eines Familienlebens aufrechterhalten zu müssen, trotzdem die großen Bengels genau Bescheid wussten. Sie hatte überhaupt eine Scheu, von diesem Zerwürfnis andere etwas merken zu lassen. Wurde sie nach ihrem Manne gefragt, so antwortete sie immer, er sei auf Montage. Sie ging sogar jetzt noch manchmal zu Ennos Eltern, brachte ihnen was zu essen oder ein paar Mark, gewissermaßen als Entschädigung für das Geld, das der Sohn sich dann und wann von der kümmerlichen Rente der Eltern erschlich.
Aber innerlich war sie ganz fertig mit dem Mann. Er hätte sich sogar ändern und wieder arbeiten und sein können wie in den ersten Jahren ihrer Ehe, sie hätte ihn nicht wieder aufgenommen. Sie hasste ihn nicht etwa, er war so ein reiner Garnichts, dass man nicht einmal Hass gegen ihn aufbringen konnte, er war ihr einfach widerlich, wie ihr Spinnen und Schlangen widerlich waren. Er sollte sie bloß in Ruhe lassen, nur nicht sehen wollte sie ihn, dann war sie schon zufrieden!
Während Eva Kluge so vor sich hin dachte, hatte sie ihr Essen auf die Gasflamme gesetzt und die Wohnküche aufgeräumt – die Kammer mit ihrem Bett machte sie schon immer am frühen Morgen zurecht. Während sie nun die Brühe schön brodeln hörte und ihr Duft sich durch die ganze Küche zu verbreiten anfing, machte sie sich an den Stopfkorb – mit den Strümpfen war es ein ewiges Elend, sie zerriss am Tage oft mehr, als sie stopfen konnte. Aber sie war der Arbeit darum nicht böse, sie liebte diese stille halbe Stunde vor dem Essen, wenn sie behaglich in weichen Filzschuhen auf dem Korbstuhl sitzen konnte, die schmerzenden Füße weit von sich gestreckt und ein wenig einwärts gedreht – so ruhten sie am besten aus.
Nach dem Essen wollte sie an ihren Liebling, den Ältesten, an Karlemann wollte sie schreiben, der in Polen war. Sie war ganz und gar nicht mit ihm einverstanden, besonders nicht, seit er in die SS eingetreten war. Man hörte in der letzten Zeit sehr viel Schlechtes von der SS, besonders gegen die Juden sollte sie so gemein sein. Aber das traute sie ihm doch nicht zu, dass ihr Junge, den sie einmal unter dem Herzen getragen hatte, Judenmädchen erst schändete und dann gleich hinterher erschoss. So was tat Karlemann nicht! Woher sollte er es auch haben? Sie hatte nie hart oder gar roh sein können, und der Vater war einfach ein Waschlappen. Aber sie würde doch versuchen, im Brief eine Andeutung zu machen, dass er anständig bleiben müsse. Natürlich musste diese Andeutung ganz vorsichtig gemacht werden, dass nur Karlemann sie verstand. Sonst bekam er Schwierigkeiten, wenn der Brief dem Zensor in die Finger geriet. Nun, sie würde schon auf irgendwas kommen, vielleicht würde sie ihn an ein Kindheitserlebnis erinnern, wie er ihr damals zwei Mark gestohlen und Bonbons dafür gekauft hatte oder, besser noch, als er sich schon mit dreizehn an die Walli rangemacht hatte, die nichts war wie eine gemeine Nutte. Was das damals für Schwierigkeiten gemacht hatte, ihn von dem Weibe wieder loszukriegen – er war solch ein Wutkopf manchmal, der Karlemann!
Aber sie lächelt, als sie an diese Schwierigkeiten denkt. Alles kommt ihr heute schön vor, was mit der Kindheit der Jungens zusammenhängt. Damals hatte sie noch Kraft in sich, sie hätte ihre Bengels gegen die ganze Welt verteidigt und gearbeitet bei Tag und gearbeitet bei Nacht, bloß um ihnen nichts abgehen zu lassen, was andere Kinder mit einem anständigen Vater bekamen. Aber in den letzten Jahren ist sie immer kraftloser geworden, ganz besonders, seit die beiden in den Krieg ziehen mussten. Nein, dieser Krieg hätte nicht kommen dürfen; war der Führer wirklich ein so großer Mann, hätte er ihn vermeiden müssen. Das bisschen Danzig und der schmale Korridor – und darum Millionen Menschen in tägliche Lebensgefahr gebracht – so was tat kein wirklich großer Mann!
Aber freilich, die Leute erzählten ja, dass er so was wie unehelich sei. Da hatte er wohl nie eine Mutter gehabt, die sich richtig um ihn kümmerte. Und so wusste er auch nichts davon, wie Müttern zumute sein kann in dieser ewigen, nie abreißenden Angst. Nach einem Feldpostbrief war es ein, zwei Tage besser, dann rechnete man, wie lange es her war, seit er abgeschickt worden war, und die Angst begann von Neuem.
Sie hatte längst den Stopfstrumpf sinken lassen und nur so vor sich hin geträumt. Nun steht sie ganz mechanisch auf, rückt die Brühe von der besser brennenden Flamme auf die schwächere und setzt den Kartoffeltopf auf die bessere auf. Sie ist noch dabei, als bei ihr die Klingel geht. Sofort steht sie wie erstarrt. Enno! denkt es in ihr, Enno!
Sie setzt den Topf leise hin und schleicht auf ihren Filzsohlen lautlos zur Tür. Ihr Herz geht wieder leichter: vor der Tür, ein bisschen ab, sodass sie gut gesehen werden kann, steht ihre Nachbarin, Frau Gesch. Sicher will sie wieder was borgen, Mehl oder ein bisschen Fett, das sie stets wiederzubringen vergisst. Aber Eva Kluge bleibt trotzdem misstrauisch. Sie sucht, soweit es das Guckloch in der Tür erlaubt, den ganzen Treppenflur ab und lauscht auf jedes Geräusch. Aber alles ist in Ordnung, nur die Gesch scharrt manchmal ungeduldig mit den Füßen oder sieht nach dem Guckloch hin.
Eva Kluge entschließt sich. Sie macht die Tür auf, aber nur so weit die Kette es zulässt, und fragt: »Na, was soll’s denn sein, Frau Gesch?«
Sofort überstürzt Frau Gesch, eine abgemergelte, halb zu Tode gearbeitete Frau, deren Töchter auf Kosten der Mutter einen guten Tag leben, sie mit einer Flut von Klagen über die endlose Wascherei, immer anderer Leute dreckige Wäsche waschen und nie satt zu essen, und die Emmi und die Lilli tun rein gar nichts. Nach dem Abendessen gehen sie einfach weg und lassen der Mutter den ganzen Abwasch. »Ja, und Frau Kluge, was ich Sie bitten wollte, ich habe da im Rücken was, ich glaube, ’nen Furunkel oder doch was Eitriges. Wir haben bloß einen Spiegel, und meine Augen sind so schlecht. Wenn Sie sich das mal ansehen wollten – ich kann doch wegen so was nicht zum Doktor, wann habe ich denn Zeit für ’nen Doktor? Aber vielleicht können Sie es sogar ausdrücken, wenn’s Ihnen nicht eklig ist, manche sind in so was eklig …«
Während Frau Gesch klagend immer so weiterredet, hat Eva Kluge ganz mechanisch die Kette losgemacht, und die Frau ist in die Wohnküche hineingekommen. Eva Kluge hat die Tür wieder zuziehen wollen, da hat sich ein Fuß dazwischengezwängt, und schon ist auch Enno Kluge in ihrer Wohnung. Sein Gesicht ist ausdruckslos wie immer; dass er doch etwas erregt ist, merkt sie nur daran, dass seine fast haarlosen Lider stark zittern.
Eva Kluge steht mit hängenden Armen da, ihre Knie beben so sehr, dass sie sich am liebsten zu Boden sinken ließe. Der Redestrom von Frau Gesch ist ganz plötzlich versiegt, schweigend sieht sie in die beiden Gesichter. Es ist ganz still in der Küche, nur der Brühentopf brodelt leise.
Schließlich sagt Frau Gesch: »Na, nun habe ich Ihnen den Gefallen getan, Herr Kluge. Aber ich sage Ihnen: einmal und nicht wieder. Und wenn Sie Ihr Versprechen nicht halten und fangen das wieder an mit der Nichtstuerei und dem Kneipenlaufen und dem Pferdewetten …« Sie unterbricht sich, sie hat in das Gesicht von Frau Kluge gesehen, sie sagt: »Und wenn ich Mist gemacht habe, ich helfe Ihnen auf der Stelle, das Männeken rauszuschmeißen, Frau Kluge. Wir beide schaffen das doch wie nischt!«
Eva Kluge macht eine abwehrende Bewegung. »Ach, lassen Sie schon, Frau Gesch, es ist ja doch alles egal!«
Sie geht langsam und vorsichtig zum Korbstuhl und lässt sich in ihn sinken. Sie nimmt auch wieder den Stopfstrumpf zur Hand, aber sie starrt ihn an, als wüsste sie nicht, was das ist.
Frau Gesch sagt ein wenig gekränkt: »Na, denn guten Abend oder Heil Hitler – ganz wie den Herrschaften das lieber ist!«
Hastig sagt Enno Kluge: »Heil Hitler!«
Und langsam, als erwache sie aus einem Schlaf, antwortet Eva Kluge: »Gute Nacht, Frau Gesch.« Sie besinnt sich. »Und wenn wirklich was mit Ihrem Rücken ist«, setzt sie hinzu.
»Nee, nee«, antwortet Frau Gesch, schon vor der Tür, hastig. »Mit dem Rücken ist nichts, das habe ich nur so gesagt. Aber ich misch mich gewiss nicht wieder in die Sachen von anderen Leuten. Ich seh’s ja doch: ich habe nie Dank davon.«
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе