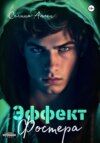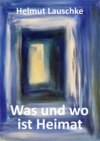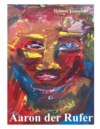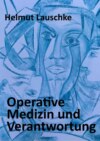
Объем 120 страниц
О книге
Die Einschränkung der Funktion und körperlichen Bewegungsfreiheit geht einher mit der seelischen Not der permanenten Nötigung, was die Einbuße und schmerzhafte Erkenntnis ist, dass die Fähigkeit zur freien Entscheidung einen schweren Schlag erlitten hat, der bis zur totalen Unfähigkeit führt. Der Freiheitsverlust wird umso größer, je weniger geh- und greiffähig die Persönlichkeit ist.
Die Integrität setzt die Unversehrtheit voraus, die aus medizinischen Gründen verletzt wird; sie geht verloren und kommt nicht wieder. Die Chirurgie hat in die Ursprünglichkeit des Zusammengehörigen als Einheit hinein geschnitten. Dabei mögen die Vernunftsgründe beachtlich sein. Gegenüber dieser Ursprünglichkeit sind sie jedoch von untergeordneter Bedeutung. Es ist das Bild vom gewachsenen Baum, dem mit der Axt eine Wunde geschlagen wird, die «blutet». Der Einschlag ist gravierend, dass die «Blutstillung» und damit die Wundheilung nicht mehr möglich ist. Das Abtrennen hat der Individualität die Unversehrtheit für immer genommen und ihr den Schmerz im Dasein mit der Unvollständigkeit und Abhängigkeit für immer gegeben..
Der versehrte Mensch ist seelisch und körperlich gebrechlich. Er muss sich vor Dingen beugen, die er bislang «aufrecht» verrichtet oder abgewehrt hat. Die Freiheit der Bewegung ist durch die Beschädigung geistig wie körperlich eingeschränkt. Damit ist der Mensch in seiner Ganzheit unfrei geworden. Man ist aus der Normalität weggerutscht und hält das abgeschnittene Bein ständig «in den Händen». Das Abtrennen einer Gliedmaße ist ein hochtraumatischer Eingriff. Das gilt für die seelische Belastung im Besonderen.
Viele Menschen und vor allem Kinder verloren das Leben durch Landminen. Verletzte, die die Minen überlebten, wurden im Hospital operiert, was sich auf die Nachamputation an den Armen und Beinen beschränkte. Oft ging dem eine Operation an einer oder mehreren Körperhöhlen voraus. Diese Art der Trauma-Chirurgie war eine schwere Belastung für Körper und Seele.
Жанры и теги
Оставьте отзыв