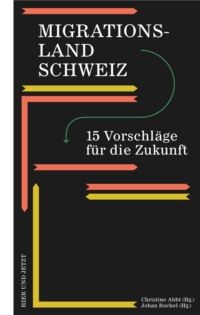Читать книгу: «Migrationsland Schweiz», страница 3
DEMOKRATIE GRENZENLOS
In einer Welt, die immer stärker von Mobilität geprägt ist, in einer Welt, in der immer mehr Menschen in zwei oder mehr Staaten Teile ihres Lebens verbringen, wird man sich aber auch Gedanken darüber machen müssen, ob der Nationalstaat als Aktionsradius der Demokratie genügt. Das Versprechen dieses Nationalstaats ist die exklusive Deckungsgleichheit von Gesellschaft, Politik und Territorium, also von sozialem, politischem und geografischem Raum. Nun haben wir es spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bei einer zunehmenden Anzahl grenzüberschreitender wirtschaftlicher, sozialer und politischer Prozesse mit einer Emanzipation des sozialen Raums vom geografischen Raum zu tun. Sozialräume und geografische Räume stimmen daher immer weniger überein. Die geografischen Räume rücken durch Technik und Kommunikation näher zusammen; gleichzeitig werden die sozialen Räume einerseits komplexer, stapeln sich quasi auf; das heisst, es finden sich auf engstem Raum unterschiedlichste Lebensformen und soziale Netzwerke. Andererseits weiten sich die sozialen Räume auch aus, bilden geografisch nicht mehr verbundene Einheiten. Räumlich weit auseinander lebende Communities stellen durch die Mittel des Transports und der Kommunikation einen gemeinsamen sozialen Raum her.9 Wenn soziale Interaktionen aber losgelöst vom geografischen Raum stattfinden können, ist örtliches Zusammensein keine zwingende Bedingung mehr für gemeinsame politische Rechte. Es wäre zu überlegen, wie staatsbürgerschaftliche Modelle jenseits des nur flächenräumlich gedachten Staats funktionieren könnten.
Wenn Staatsbürger mit zwei oder mehr Pässen in verschiedenen Staaten ein Mitspracherecht haben, fördert das in einem ersten Schritt sicherlich die gegenseitige Wahrnehmung und die Auseinandersetzung mit politischen Prozessen in Ländern, mit denen man eine gewisse Schnittmenge an gemeinsamen Bürgerinnen und Bürgern hat. Mitreden und mitentscheiden ist dann nicht mehr an den Wohnsitz gebunden, sondern auch möglich, wenn man an anderen Orten der Welt lebt. Man beteiligt sich dann aus räumlicher Distanz, aber dennoch mit einem Gefühl der Zugehörigkeit am politischen Prozess.
Zweitens wären in die demokratischen Entscheidungsprozesse Betroffene unabhängig von ihrer staatlichen Zugehörigkeit einzubringen, sofern sie sich nicht nur temporär in diesen Regionen aufhalten, sondern über längere Zeit dort leben. In einem dritten Schritt wären demokratische Entscheidungsprozesse über die nationalstaatliche Ebene hinaus in Gang zu setzen. Die EU hat mit ihrer Europäischen Bürgerinitiative, die im schweizerischen Sprachgebrauch eher einer Petition entspricht, ein solches Instrument etabliert, das aber noch nicht wirklich als Instrument demokratischer Mitbestimmung funktioniert.10 Solche Bestrebungen müssten ausgebaut werden, auch auf der Ebene grenzüberschreitender regionaler Entscheidungsprozesse, da diese häufig die Bewohnerinnen und Bewohner einer Region betreffen, auch wenn sie in verschiedenen Staaten leben.
Wäre es also denkbar, sich die Ausübung demokratischer Rechte in Zukunft neu vorzustellen? Einerseits würde es selbstverständlicher, dass Menschen in zwei oder sogar mehr Staaten mitbestimmen dürfen, weil eben immer mehr Menschen zwei oder mehr Pässe besitzen. Das existiert als Möglichkeit schon heute, wäre also lediglich eine quantitative Ausweitung bereits bestehender demokratischer Rechte.
Zweitens aber würden vermehrt Menschen Mitspracherechte bekommen, die nicht Bürgerinnen und Bürger, aber Bewohnerinnen und Bewohner eines bestimmten Territoriums sind. Dies hingegen wäre eine qualitative Ausweitung demokratischer Rechte, weil sie an vielen Orten noch nicht existiert. Einige Leute dürften angesichts eines solchen Szenarios eine unkontrollierbare Basisdemokratie befürchten. Andere hingegen würden eine Ausweitung der Zivilgesellschaft erkennen, die ein dringend benötigtes Gegengewicht demokratischer Kontrolle schaffen könnte, welches das heutige Ungleichgewicht zwischen faktischer Globalisierung fast aller Lebensbereiche einerseits und staatlicher Begrenzung der Entscheidungsmechanismen andererseits korrigieren und demokratisch verfassten Gremien wieder mehr Macht einräumen würde.
Doch um dieses Ungleichgewicht wirklich beheben oder zumindest verkleinern zu können, wären wohl noch radikalere Schritte der Demokratisierung zu denken, nämlich die Ausweitung demokratischer Entscheide über einzelne Staaten hinaus, also die gemeinsame demokratische Einflussnahme von Menschen, die in mehreren Staaten leben.
Warum sollte Demokratie, einst aus der Polis geboren und dann lange Zeit auf die Ebene des Nationalstaats beschränkt, im Rahmen der Globalisierung nicht in der Lage sein, einen weiteren Schritt zu machen und sich auf neuen Ebenen zu verankern? Und wer, wenn nicht die Schweiz mit ihren langen direkt-demokratischen Traditionen, wäre der richtige Anschieber und Taktgeber, um solche Entwicklungen gemeinsam mit anderen Staaten anzustossen? Wäre der Schritt so viel mutiger als die demokratischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts in einem Umfeld, das zum überwiegenden Teil noch völlig undemokratisch funktionierte? Und wäre es nicht ein folgerichtiger weiterer Schritt, um der Demokratie auch im Zeitalter der Globalisierung und der Migration die ihr gebührende Stellung zu sichern?
Walter Leimgruber ist Professor für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der Universität Basel. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Migration sowie gesellschaftliche Mechanismen der Integration und Ausgrenzung.
VORSCHLAG 2

Kein Stimmrecht – trotzdem mitstimmen
JOACHIM BLATTER, CLEMENS HAUSER, SONJA WYRSCH
Fast alle Schweizerinnen und Schweizer sind stolz auf ihre Demokratie. Und sie haben auch allen Grund dazu: Sie bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern umfangreiche Möglichkeiten zur intensiven politischen Partizipation; vor allem aber zeichnet sie sich durch eine politische Kultur aus, die ausgesprochen problemlösungs- und konsensorientiert ist. So ist es denn kein Wunder, dass Schweizerinnen und Schweizer im internationalen Vergleich die grösste Zufriedenheit darüber äussern, wie die Demokratie in ihrem Land funktioniert. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe dunkler Flecken auf der weissen Weste der Schweizer Demokratie: Die massive Bevorteilung ländlich-konservativer gegenüber städtisch-progressiver Interessen durch den strukturkonservativen Föderalismus, intransparente Parteien- und Kampagnenfinanzierung und eine besonders egoistische Finanz- und Steuerpolitik, die auf Kosten anderer Länder und Völker geht.1
Die Zwiespältigkeit der Schweizer Demokratie tritt allerdings besonders deutlich bei einem Thema hervor: bei der Frage nach der In- beziehungsweise Exklusivität der Demokratie. Für viele Beobachtende erscheint die Schweizer Demokratie mit ihren direktdemokratischen Instrumenten besonders inklusiv. Denn in diesem System können ja alle Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden, und nicht nur ein kleiner Kreis von Repräsentanten. Nicht umsonst dient die schweizerische direkte Demokratie in den Nachbarländern denjenigen Kräften als Vorbild, die sich selbst als Aussenseiter und als Stimme des – einfachen – Volkes stilisieren. Dies war in den 1980er-Jahren bei den Grünen nicht anders als heute bei der Alternative für Deutschland (AfD), dem Front National (FN) oder der United Kingdom Independence Party (UKIP). Dabei wird übersehen, dass es in der Schweiz nicht die direkte Demokratie ist, die zu einer hohen Inklusivität führt, sondern die konsensorientierte Kultur und die damit einhergehenden Strukturen der Konkordanzdemokratie.
Den meisten ist noch bewusst, dass die Schweiz bei der Einführung des Frauenstimmrechts nicht gerade eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Dies wird aber als schrullige Besonderheit abgetan, und es wird nicht erkannt, dass der besonders lange Ausschluss von 50 Prozent der einheimischen erwachsenen Bevölkerung der direkten Demokratie zu verdanken war. Es brauchte den Druck von aussen, bis die Mehrheit der Schweizer Männer 1971 nach mehrmalig gescheiterten Anläufen bereit war, die Frauen mitbestimmen zu lassen. Dort, wo die Demokratie besonders «direkt» war und ist – in der Appenzeller Landsgemeinde –, konnte man sich sogar gar nie dazu durchringen. Hier brauchte es «fremde Richter», um den Frauen auch im letzten Stand zum Stimmrecht zu verhelfen.
Die Schweiz ist auch heute noch meilenweit von einem universellen Wahl- und Stimmrecht für die gesamte erwachsene Wohnbevölkerung entfernt. Da das Stimmrecht – zumindest auf eidgenössischer Ebene und in den meisten Wahlen und Abstimmungen auf kantonaler und kommunaler Ebene – an den Bürgerstatus gebunden ist, in der Schweiz jedoch fast jede vierte Person der gesamten Wohnbevölkerung keinen Schweizer Pass besitzt, sind auch heute noch 25 Prozent aller erwachsenen Bewohnerinnen und Bewohner weitgehend von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen. Diese Tatsache wird im Gegensatz zu vielen anderen Aspekten der Migration in der Öffentlichkeit kaum diskutiert.
Vielleicht liegt dies ja daran, dass der Ausschluss von Migrantinnen und Migranten aus dem Stimmvolk «normal» ist? Um dies herauszufinden, starteten zwei Studierende der Universität Luzern ein Projekt: Zum einen befragten sie die normativen Demokratietheorien daraufhin, ob und wann sie eine Inklusion von Immigrantinnen und Immigranten in den «demos» verlangen. Zum anderen entwickelten sie ein Messinstrument, mit dem man die In- beziehungsweise Exklusivität der europäischen Länder in Bezug auf Migrantinnen und Migranten in umfassender und systematischer Weise vergleichen kann. Dass die Schweiz bei der Inklusion von Migrantinnen und Migranten im internationalen Vergleich keine gute Figur macht, überrascht kaum. Die Messungen des Immigrant Inclusion Index (IMIX) weisen aber noch auf weitere aufschlussreiche Aspekte hin, die wir im Folgenden beschreiben werden. Um zu zeigen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dieses Demokratiedefizit abzubauen, werden wir in einem zweiten Teil Initiativen vorstellen, die in anderen Ländern Europas und vor allem in Deutschland bereits umgesetzt wurden. Dies in der Hoffnung, damit positive Impulse zu geben und die unbefriedigende Situation in der Schweiz und in anderen Ländern zu ändern.
DER IMMIGRANT INCLUSION INDEX
Im Jahr 2013 beteiligten sich Andrea Blättler und Samuel Schmid an einem forschungsorientierten Seminar mit dem Titel «Zur Qualität von Demokratien und Demokratiemessinstrumenten», das von Professor Joachim Blatter an der Universität Luzern angeboten wurde. Die beiden Studierenden erkannten sofort, dass selbst die jüngsten Demokratiemessinstrumente wie beispielsweise das Demokratiebarometer, das vom Wissenschaftszentrum Berlin zusammen mit der Universität Zürich entwickelt wurde, in einer wichtigen Hinsicht ein Defizit aufweisen: Sie berücksichtigen bei ihrer Messung der Qualität von Demokratien nicht oder nur unzureichend, wie gut Demokratien Immigrantinnen und Immigranten in den politischen Prozess einbinden. Um dies zu belegen, entwickelten die beiden zusammen mit dem Dozenten ein eigenes Messinstrument: den Immigrant Inclusion Index (IMIX).
Der erste Schritt bei der Entwicklung des IMIX bestand in der Beantwortung der Frage: Müssen demokratische Gemeinschaften Migrantinnen und Migranten eigentlich inkludieren? Alle wichtigen Strömungen der Demokratietheorie sind sich in dieser Frage einig:2 Ja, das müssen sie, und dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen. Der erste und wichtigste Grund ist, dass alle Erwachsenen, die politischer Herrschaft unterworfen sind, in der Lage sein müssen, sich an der Kontrolle dieser Herrschaft zu beteiligen. In anderen Worten: Man kann nur von jemandem erwarten, dass er sich an die Gesetze eines Landes hält, wenn er bei der Gestaltung dieser Gesetze auch mitwirken kann. Darüber hinaus tragen Immigrantinnen und Immigranten durch die Übernahme von politischer Verantwortung und von politischen Ämtern auch dazu bei, dass sich die politische Gemeinschaft als Ganzes selbstbestimmen kann. Dies ist insbesondere in der Schweiz mit ihrem Milizsystem von grosser Bedeutung. Mit der politischen Inklusion ist auch eine gegenseitige Anerkennung von Einheimischen und Migranten verbunden. Dies wiederum führt zu einer erhöhten Identifikation der beiden Gruppen mit Staat und Gesellschaft. Eine dauerhafte Exklusion führt dagegen zu Abgrenzung und Distanzierung.
Während sich praktisch alle einig sind, dass Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in einem Land leben, eine Stimme im politischen Prozess erhalten sollten, gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wann dies zu geschehen hat. Für diejenigen, die vor allem den Schutz der individuellen Rechte und Interessen der Migrantinnen und Migranten im Auge haben, muss die Inklusion möglichst früh erfolgen. Bei denjenigen, die gemeinsame Werte als Voraussetzung einer funktionierenden Demokratie betrachten und die sich um die politische Kultur eines Landes Sorgen machen, ist die Sache nicht so klar. Für Konservative kommt eine Inklusion erst in Betracht, wenn Migrantinnen und Migranten sich assimiliert haben und die Kultur der Einheimischen teilen. Progressive verweisen darauf, dass eine frühe politische Inklusion dazu beiträgt, dass sich Migrantinnen und Migranten für die politische Kultur eines Landes erwärmen können und dass sich die politische Kultur eines Landes durch deren Inklusion zeitgemäss weiterentwickelt. Wieder andere sehen eine gewisse Vertrautheit mit dem politischen System als notwendige Voraussetzung, um produktiv mitwirken zu können. Der IMIX schliesst sich einem sich immer mehr herauskristallisierenden Konsens an, der davon ausgeht, dass Demokratien denjenigen, die fünf Jahre legal und durchgehend in einem Land gelebt haben, das Wahl- beziehungsweise Stimmrecht geben sollten. Allein durch die Einführung von Beiräten ist die politische Inklusion unzureichend, denn nur wenn Immigrantinnen und Immigranten auch eine Stimme haben, die bei den Abstimmungen und Wahlen zählt, werden sich Politikerinnen und Politiker um ihre Interessen kümmern.
DIE SCHWEIZ IM INTERNATIONALEN VERGLEICH
Der nächste Schritt im Hinblick auf den IMIX bestand darin, ein konkretes Messinstrument zu entwickeln, mit dem man in systematischer Art und Weise die Situation in verschiedenen Demokratien vergleichen kann. Der IMIX misst die politische In- beziehungsweise Exklusivität von nationalen Demokratien gegenüber Migrantinnen und Migranten in zweierlei Hinsicht: Zum einen wird anhand der Gesetzgebung eines Landes eruiert, wie inklusiv das Land de jure ist. Zum anderen wird berechnet, wie viele der Immigrantinnen und Immigranten, die eigentlich inkludiert werden müssten, de facto inkludiert sind. Beide Perspektiven haben Vor- und Nachteile: Die in den Gesetzen eines Landes verankerte Inklusivität verkörpert den in demokratischen Prozessen festgelegten Willen der Einheimischen sowie denjenigen der bereits Inkludierten. Allerdings gibt es jenseits der einschlägigen Gesetze weitere Hürden bei der Inklusion, weshalb die Gesetze die reale Situation manchmal nur sehr unzureichend abbilden. Deswegen erscheint eine Berücksichtigung der realen Inklusivität notwendig. Eine alleinige Bewertung auf der Basis solcher Zahlen ist aber auch problematisch, weil die reale Inklusivität auch durch Faktoren beeinflusst werden kann, für die nicht die Demokratie des Landes verantwortlich ist – zum Beispiel die Staatsbürgerschaftsgesetze der Herkunftsländer.
Der IMIX berücksichtigt zwei Möglichkeiten, wie Demokratien Immigrantinnen und Immigranten inkludieren können: durch die Einbürgerung oder durch die Einführung eines Ausländerstimmrechts – angemessener wäre der Begriff «Bewohnerinnenstimmrecht». Obwohl wir der Ansicht sind, dass es für das Ausländerinnen- und Ausländerstimmrecht ebenso viele gute demokratietheoretische Argumente gibt wie für die Einbürgerung, wurde im IMIX die Einbürgerung doppelt gewichtet. Dies zum einen, weil im theoretischen und praktischen Diskurs Letzteres immer noch als Königsweg gilt. Zum anderen, weil es angemessen erschien, im Zweifelsfall eine eher konservative Position einzunehmen, um die Akzeptanz des IMIX und seiner Ergebnisse zu stärken. Für die beiden Perspektiven und die beiden Möglichkeiten der Inklusion wurden dann konkrete Indikatoren festgelegt, und für die meisten Mitglieder der Europäischen Union und für die Schweiz Daten gesucht.

Inklusivität europäischer Nationalstaaten in Bezug auf Immigrantinnen und Immigranten.  = Durchschnitt. Quelle: Blatter, Schmid, Blättler, 2016 (siehe Anm. 3).
= Durchschnitt. Quelle: Blatter, Schmid, Blättler, 2016 (siehe Anm. 3).
Insgesamt ergab sich folgendes Bild: Auch in den bestentwickelten Demokratien Europas sind wir von einem universellen Wahlrecht noch weit entfernt. Einem grossen Teil der erwachsenen Wohnbevölkerung wird bis heute das Stimm- und Wahlrecht verwehrt. Dies lässt sich unabhängig davon feststellen, ob wir die Gesetze der Länder analysieren oder die De-facto-Inklusivität betrachten. Es gibt zwischen den Ländern aber deutliche Unterschiede: Skandinavische Länder sowie Belgien und die Niederlande sind besonders inklusiv, wohingegen die deutschsprachigen Länder, insbesondere auch die Schweiz, sich als besonders exklusiv erweisen. Die hohe Exklusivität der Schweiz lässt sich dabei nicht nur damit erklären, dass das Land viele Migranten anzieht und diese im Rahmen der bilateralen Verträge auch einwandern liess. Die Schweiz schneidet auch bei der Vermessung ihrer De-jure-Inklusivität sehr schlecht ab, was zeigt, dass sie Einwandernde nicht oder nur sehr zögerlich inkludiert beziehungsweise inkludieren will.
Auch Deutschland schneidet beim IMIX kaum besser ab als die Schweiz. Das leicht bessere Abschneiden resultiert aus der Mitgliedschaft in der Europäischen Union, denn alle EU-Länder müssen den Bürgerinnen und Bürgern anderer EU-Länder auf der kommunalen Ebene das Wahlrecht zugestehen.3 Allerdings gab es in Deutschland in den letzten Jahren bürgerschaftliche Initiativen, die darauf ausgerichtet sind, die demokratischen Defizite, die durch Exklusion von Migranten und anderen Betroffenen entstehen, zu thematisieren und sie etwas zu reduzieren. Zwei dieser Initiativen stellen wir im Folgenden vor.
FREIBURGER «WAHLKREIS 100 %»
Bei den Kommunalwahlen sind in Deutschland auch ausländische Staatsangehörige wahlberechtigt, allerdings nur jene, die einen EU-Pass vorzeigen können. Für sie gelten dieselben Voraussetzungen wie für deutsche Staatsangehörige: Nach drei Monaten gemeldetem Wohnsitz in einer Kommune erhalten sie ihre Wahlbenachrichtigung und können am Wahlsonntag ihre Stimme für die Parlamente der Kommunen und Kreise abgeben. Der überwiegende Teil der ausländischen Staatsangehörigen in Deutschland kommt aber nicht aus anderen EU-Ländern. Sie mögen drei Monate oder 30 Jahre im Gemeinwesen gelebt haben, ihre Stimme ist nicht gefragt und zählt nicht. Dies bedeutet, dass in der Bundesrepublik Deutschland 7,8 Millionen der erwachsenen Wohnbevölkerung kein Wahlrecht besitzen.
Im Südwesten der Bundesrepublik allerdings gibt es seit 14 Jahren eine Ausnahme: Neben dem offiziellen Wahlkreis werden in einem zusätzlichen Wahlkreis, dem Freiburger «Wahlkreis 100 %», die nicht-wahlberechtigten 19 000 Migrantinnen und Migranten zu einer symbolischen Stimmabgabe aufgefordert. Nach demselben Verfahren und mit denselben Parteien und Kandidaten des offiziellen Wahlkreises können die Migrantinnen und Migranten mit ihrer symbolischen Stimmabgabe am Wahlsonntag ihr Votum für ein gleichberechtigtes Wahlrecht und für demokratische Teilhabe zum Ausdruck bringen. Der «Wahlkreis 100 %» bringt sich mit Strassenständen, Wahlplakaten, Veranstaltungen, Wahlprüfsteinen, Kinospots und aktiver Medienarbeit in den Wahlkampf ein. Bei vier Wahlen in den Jahren 2002 bis 2014 konnten bis über 1000 Menschen zu einer symbolischen Stimmabgabe in den 100 %-Wahllokalen in Freiburg begrüsst werden.4 Parallel zur offiziellen Wahl wählten nicht-wahlberechtigte Migrantinnen und Migranten ihren symbolischen Gemeinderat oder Bundestag. Die abgegebenen Stimmen wurden den gewählten Bundestagsabgeordneten feierlich als «Wählerauftrag» übergeben, und die von den Migranten gewählten kommunalen Vertreter wurden zu einer symbolischen 100 %-Gemeinderatssitzung einberufen, um politische Partizipation und die Einführung des kommunalen Wahlrechts öffentlich zu debattieren.
Wahlberechtigte mit deutschem und EU-Pass sind ebenfalls aufgerufen, in den 100 %-Wahllokalen mit ihrer Stimme eine Wahl zu treffen: für oder gegen die Einführung des kommunalen Wahlrechts aller Bürgerinnen und Bürger einer Kommune – unabhängig vom Pass. Denn die demokratische Beteiligung liegt nicht nur im Interesse der ausgeschlossenen Migrantinnen und Migranten, sondern ist ein vitales Interesse einer sich demokratisch verstehenden Gesellschaft und braucht die Unterstützung derer, die zur anerkannten Wahlbevölkerung gehören.
Die Frage der Partizipation ist ein gemeinsames und einendes Thema für alle Migrationsgruppen – jenseits ethnischer und nationaler Zuschreibungen und Unterschiede. Schon die Zusammensetzung der kleinen Gruppe von 25 registrierten Vereinsmitgliedern des Freiburger «Wahlkreis 100 %›» spiegelt die selten breite Diversität einer Migrantenselbstorganisation. Staatsangehörige aller Kontinente zählen dazu, 18 haben einen Migrationshintergrund und stammen aus 17 verschiedenen Ländern. Atheisten sind genauso vertreten wie praktizierende Gläubige, deutsche ebenso wie eingebürgerte, EU- sowie Nicht-EU-Staatsangehörige. Die Bandbreite der Lebenssituationen reicht vom geduldeten Asylantragstellenden aus Afghanistan bis zum Universitätsprofessor aus Mexiko.
Seit 2008 ist der Verein «Wahlkreis 100 %» in Kontakt mit Organisationen in der Schweiz, mit der Stimmrechtsinitiative in Basel und mit gewählten Migrantinnen und Migranten («Gewählte Stimme»). Sechs Schweizer Kantone haben mittlerweile eine Wahlbeteiligung von Migrantinnen und Migranten eingeführt. Das ist ermutigend und europaweit bereits eher die Regel als die Ausnahme: 15 von 28 EU-Staaten – plus Norwegen, Island und eben zu Teilen auch die Schweiz – praktizieren heute eine unterschiedlich ausgeprägte, aber gesetzlich geregelte Wahlbeteiligung von Nicht-EU-Staatsangehörigen auf der kommunalen Ebene, einige sogar bei regionalen und nationalen Wahlen. Das leuchtende Beispiel allerdings bleibt das weit entfernte Neuseeland. Dort werden Migrantinnen und Migranten nach einem Jahr Aufenthalt demokratisch integriert und sind an allen Wahlen wahlberechtigt.
Die Kooperationen und die Vernetzung, die der Freiburger «Wahlkreis 100 %» aktiv sucht und eingeht, ergeben ein dichter werdendes Netz, das Migrantenvertretungen und Organisationen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Bremerhaven sowie in Freiburgs Partnerstädten Padua und Granada, Strassburg und Florenz verbindet. Im Rahmen eines EU-Projekts der Jahre 2014/15 mit fünf europäischen Partnern entwickelte sich das 100 %-Modell zu einem kleinen Exportschlager. Anlässlich der Kampagne «Hier lebe ich, hier wähle ich» tauchten an den Projektorten in Andalusien, nördlich von London und in der Toskana ähnliche symbolische Wahlurnen auf wie in den Strassen von New York bei den Bürgermeisterwahlen im November 2013. In Deutschland hatten in Berlin 2011 und in Sachsen-Anhalt 2016 symbolische Wahlen stattgefunden.
Würde das 100 %-Modell als Form der politischen Aktion zur Erreichung eines gleichberechtigten Wahlrechts in der Schweiz angewandt, wäre dies genaugenommen eine Art Reimport. Denn als die «New York Times» am 3. März 1957 «First Votes Cast by Swiss Woman» titelte, bezog sie sich auf 33 nicht-wahlberechtigte Bewohnerinnen des Walliser Dorfes Unterbäch, die am Abstimmungstag unter gewaltiger Medienbeachtung ihre symbolische Stimme an der Wahlurne abgaben und damit ihre politische Beteiligung einforderten. Es sollte zwar noch 14 Jahre dauern, bis ihre Stimmen an der Wahlurne auf Bundesebene tatsächlich zählten, aber noch heute ist diese symbolische Wahl ein gefeierter Meilenstein des demokratischen Fortschritts. Die Zeit ist reif für das Unterbäch der Migrantinnen und Migranten in der Schweiz.
Начислим
+70
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе