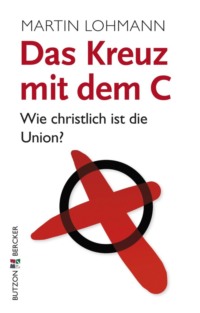Читать книгу: «Das Kreuz mit dem C», страница 3
Feigheit vor dem Freund
Das C und sein Wert
Der Blick nach Berlin lohnt immer. Nicht nur, weil dort seit einigen Jahren eine bemerkenswerte Frau das Land regiert. Nicht nur, weil Berlin eine faszinierende Stadt ist. Nicht nur, weil zwischen Reichstag und den Parlamentsgebäuden rund um ihn eine bedeutungsschwangere Atmosphäre der Wichtigkeit bei manchem Besucher aus der sogenannten Provinz das respektvolle Staunen möglich macht. Nicht nur, weil dort eine Wirklichkeit des Raumschiffs entstanden ist, gegen die ähnliche Entwicklungen im beschaulichen Bonn nichts als kaum wahrnehmbare Zuckungen waren. Nein, es ist die Symphonie aus Vergangenheit und Zukunft, die dieser Hauptstadt eine ganz eigene, eine unvergleichliche Wirklichkeit verleiht.
Nicht zuletzt ist es – zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer – auch eine neue Generation von Politikern, die der deutschen Demokratie für die medial wahrgenommene Wirklichkeit ein anderes Gesicht verleihen, als dies zu Bonner Zeiten der Fall war. Bonn, die Stadt des Grundgesetzes und der erfolgreichsten Demokratiezeit auf deutschem Boden, liegt am Rhein, ist Teil eines über zwei Jahrtausende gewachsenen Charakters, der wesentliche Züge des Christlichen trägt. In Bonn spielte und spielt Kirche eine selbstverständliche Rolle. Auch wenn sich in Bonn, das sich seit dem Verlust des Hauptstadttitels tapfer Bundesstadt nennt, vieles ändert und anno 2009 nicht mehr verglichen werden kann mit den Gründerjahren der Bundesrepublik, so ist bis heute das Christliche irgendwie da. Regelmäßiges Kirchengeläute von nicht allzu weit entfernt war im Regierungsviertel immer zu hören, wenn man wollte. Manche sagen gar, der Geist des rheinisch-katholischen Adenauers sei auch noch Jahrzehnte später nicht ganz erloschen. Rheinisch-katholisch – das weiß man im Rheinland – steht für die der rheinischen Weltoffenheit entsprechende Mentalität der Leichtigkeit des Seins, auch gegenüber allem Kirchlichen, das man zwar ernst nimmt, aber bitte nie zu ernst.
Die andere Hauptstadt
Bonn war Hauptstadt. Berlin ist es. Und hier an der Spree muss man schon etwas genauer suchen, um christliche Kultur zu entdecken. Es gibt sie. Aber sie ist keineswegs so alt und in der Geschichte verwurzelt wie im Rheinland, wo mit den Römern bereits vor zweitausend Jahren das C, um im Bild dieses Buches zu bleiben, zu den Menschen kam. Der märkische Sand konnte damals noch mehr als zwölf Jahrhunderte nicht ahnen, dass die Zivilisation auch an die Spree kommen würde. Sie kam. Mit beeindruckendem Selbstbewusstsein. Heute ist Berlin eine Metropole der Welt, die für vieles in Deutschland Maßstab ist. Eine Metropole, die zahlreichen Kulturen Heimat bietet und im wahrsten Sinne des Wortes bunt schillernd ist.
So etwas prägt. So etwas prägt auch Politiker, die aus dem ganzen Land anreisen, um hier Politik für ganz Deutschland zu machen. Berlin prägt mit seiner Macht der Faszination und Größe übrigens mehr, als das Bonn jemals wollte oder auch konnte. Irgendwie war es am Rhein leichter, seine Heimat aus seinem Wahlkreis mitzubringen und ihr Gehör zu verschaffen. Bonn prägte so gesehen nicht. Bonn ließ gewähren. Bonn war tolerant, weil es nicht anders konnte.
Berlin ist da anders. Die Atmosphäre ist hier weit weniger christlich angereichert als anderswo. Sicher, auch das Christliche hat seinen Platz. Aber eben neben vielem anderen. Vertretern der Kirchen fehlt eine Aura des etwas Besonderen. Sie sind eher so etwas wie gleichberechtigte Lobbyisten in der Schar der anderen Verbands- und Interessenvertreter. Sie sind gerne gesehene Gesprächspartner, aber sie müssen mehr um ihr politisches Beachtungsgewicht kämpfen als ihre Vorgänger in Bonn. Es ist nun einmal so. Berlin hat mit seiner säkularisierten und auch bisweilen gottlosen Wirklichkeit die Kraft, von sich aus ins Land zu wirken. Dabei weiß jeder, dass Berlin nicht Deutschland ist und Deutschland nicht Berlin. Mag sein, dass man dieses Phänomen quasi entschuldigend und, wie es jemand einmal sagte, strafmildernd durchaus gewichten muss, wenn man gerade im Blick auf den Reichstag und das Kanzleramt sowie den um diese Stätten kreisenden Mikrokosmos die Frage nach dem C stellt. Ich plädiere also für Fairness, wenn scharf und mit dem Unterton der zweifelsfrei gegebenen harten Antwort aus den anderen und womöglich selbstverständlich christlich geprägten Regionen des Landes nach dem C in der Union gefragt wird.
Das C unter vielem anderen
Ähnliches gilt übrigens auch für München. Auch München ist nicht Bayern, und Bayern ist nicht München.
Das C hat in Oberbayern eine ganz andere Verwurzelung im Leben als etwa im nördlichen Franken. Und München ist sowieso nichts als München. So wie Berlin der Mittelpunkt ist, ist es München auch. Und wie in der Bundeshauptstadt die Lebenswirklichkeit keineswegs nicht automatisch christlich ist, so ist sie es auch in der bayerischen Landeshauptstadt nicht. Obwohl in München die Liebfrauenkirche das Stadtbild so prägt wie in Berlin der Funkturm am Alexanderplatz. Die Hedwigskathedrale jedenfalls liegt etwas abseits in Berlin, obwohl sie mittendrin liegt.
Und was heißt das alles jetzt für unsere Frage? Man muss es einfach wissen und berücksichtigen, wenn C-Politiker, die sich auf der politischen Bühne in Berlin und auf den Empfängen und Tagungen in der Metropole perfekt zu bewegen verstehen, zum C befragt werden. Es wäre einfach unfair, sie mit jener Schablone zu bewerten, die vor einigen Jahrzehnten am Rhein vielleicht noch berechtigt gewesen ist. Bonn bot als Bühne allenfalls das Kanzlerfest oder die übersichtlichen Sommerfeste der Ländervertretungen. Das Beethovenfest zu Ehren des in Bonn geborenen Musikgenies fand schon wieder ohne Bundesprominenz statt. In Berlin hingegen müssen sich, wie gelegentlich von ihnen selbstbewundernd geklagt wird, die Politiker täglich entscheiden, welche der zahlreichen Einladungen sie denn wahrnehmen. Am besten alle nacheinander. Viel Ablenkung, wenig C. So ist es nun einmal. Fast könnte man sagen: Das C geht unter in Berlin.
Könnte das eine Rechtfertigung sein für nicht nur in Berlin feststellbare Entwicklungen? Oder doch nur eine Erklärung? Ist die Berliner Republik, von der man im Unterschied zur nie so bezeichneten Bonner Republik unmittelbar nach dem Umzug vom Rhein an die Spree zu reden begonnen hat, längst östlicher und heidnischer geworden? Mit entsprechender Ausstrahlung auf – nicht zuletzt – die C-Politiker und damit auf das von der Zentrale aus geprägte und überall im Lande wahrgenommene Profil der C-Parteien? War es vielleicht doch ein Fehler, dass nach dem Fall der Mauer verhindert wurde, einen Katholischen Arbeitskreis in der Union zu gründen – gleichsam als Ergänzung zum Evangelischen Arbeitskreis? Diesen hatten engagierte Christen in der Politik zu Bonner Zeiten ins Leben gerufen, um der im Rheinland vornehmlich katholisch geprägten CDU ein ökumenisches Gegengewicht zu bieten. Doch entsprechend engagierte Versuche, mit demselben Argument nach der Wende ein sichtbares katholisches Forum zu installieren, scheiterten in den Neunzigerjahren, auch am Widerstand eines prominenten protestantischen Unionspolitikers. Der dann ins Leben gerufene und nach dem früheren Kölner Erzbischof und Sozialethikers benannte Kardinal-Höffner-Kreis schaffte den Sprung aus einem eher unverbindlichen Gesprächskreis ohne besondere Wirkung ins mehr als nur Nette und Freundliche nicht, obwohl er bei der Bundestagsfraktion der Union angesiedelt ist und als Vorsitzenden einen Unionspolitiker hat. Einen in der Partei verankerten und als Teil dieser Partei wahrgenommenen Katholischen Arbeitskreis, vergleichbar mit dem Evangelischen Arbeitskreis, mit einer eigenen Publikation gibt es bis heute nicht. Leider.
Ganz anders, aber religiös
Im Konzert der Meinungen und Überzeugungen scheint das C im pluralistischen Berlin kaum oder nur eine geringe Chance zu haben. Ist das vielleicht einer der Gründe, warum sich die neue deutsche Republik ganz anders präsentiert als die vermeintlich christlicher geprägte alte Republik des Westens? Ist die Klage, die man gelegentlich hört, dass der Geist der Berliner Republik letztlich an vielem schuld sei bis hin zur Verdunstung des C in der Union, ernst zu nehmen? Wohl kaum. Es wäre zu kurz gesprungen, derart monokausal Veränderungen erklären zu wollen. Richtiger wird sein, daran zu erinnern, dass die Union, dass deren Köpfe Teil einer Gesellschaft sind, die sich stets verändert und auch schon verändert hat. Irgendetwas wird schon dran sein an dem Spruch, dass jede Gesellschaft die Politiker hat, die sie verdient. Will sagen: Die Politiker sind Teil der Gesellschaft und haben eben jene Gesellschaft, aus der heraus sie kommen, widerzuspiegeln. Von einer Vorbildfunktion und der Verantwortung, die sie etwa als gewählte Vertreter des Souveräns zu tragen haben, einmal abgesehen: Sollen sie völlig anders sein als die deutsche Wirklichkeit? Und ist diese nicht längst weitgehend vom C befreit? Sollen Unionsvertreter also päpstlicher als der Papst sein?
Viel wurde in der Vergangenheit darüber diskutiert und spekuliert, dass die Zeiten des Religiösen, also auch die Zeiten des C, mehr und mehr der Geschichte angehören. Von Säkularisierung war die Rede, ja selbst innerhalb der Kirchen wurde ein säkularisiertes Christentum beklagt. Der moderne Mensch, so hörte man ab und an, sei ein aufgeklärter und kaum mehr religiöser. Die moderne Gesellschaft, also auch und gerade die deutsche, werde eine entchristlichte Gesellschaft sein, eine, in der es vielleicht noch christliche Angebote im Supermarkt der Meinungen geben könne, aber eben keine mehr, in der das mit dem Christentum verbundene Religiöse einen markanten Stellenwert haben werde.
Was die östlichen Länder des wiedervereinten Deutschland betrifft, so ist tatsächlich zu beobachten, dass es christenfreie Zonen gibt. Tatsächlich gibt es hier wie nirgendwo auf dem Kontinent Landstriche, in denen der Kommunismus ganze Arbeit bis in den Wurzelgrund geleistet hat. Nirgendwo sonst mit Ausnahme von Teilen Tschechiens gibt es derart C-freie Zonen. In entsprechenden Untersuchungen werden als religiös besonders entleerte Regionen Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt genannt – im Unterschied zu den religiös stärkeren Regionen wie Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ob die C-freie Wirklichkeit im Osten aber prägend sein kann und sollte für ganz Deutschland und seine C-Parteien, ob das gar ein Ausweis von Aufklärung und Freiheit sein könnte, das darf zumindest heftig bestritten und debattiert werden. Und mit Modernität hat es wohl auch nichts zu tun, wenn man den Stifter des C in der Darstellung am Kreuz für ein gewagtes und absurdes Kunstwerk hält und allen Ernstes noch nicht einmal kulturgeschichtlich eine Ahnung davon hat, dass es Jesus Christus wirklich gegeben hat.
Deutschland – ein säkularisiertes und religionsfreies Land? Kann die Union also getrost weniger C zulassen, weniger christlich sein als einst, weil ja ohnehin das C im Volk verdunstet? Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung wartet diesbezüglich mit Überraschungen auf. Dort kommt man – etwa im Januar 2009 – nach sorgfältigen Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass Deutschland ein religiöses Land ist. Sic! Denn die meisten Deutschen gehören einer Religionsgemeinschaft an. Und die soziale Infrastruktur ist vor allem von christlichen Institutionen, Angeboten und Einrichtungen geprägt. Schulen, Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen, Kindergärten – die meisten sind in kirchlicher Trägerschaft. Präsent ist das C auch durch Vereine und Verbände, durch Kinder- und Jugendgruppen und zahlreiche Aktivitäten, nicht zuletzt von Menschen im Ehrenamt. Gewiss: In Oberbayern ist das eher und häufiger zu erfahren als in Berlin oder Cottbus. Aber insgesamt lässt sich feststellen, dass das C im Leben der Deutschen erkennbar vorhanden ist. Mal mehr, mal weniger profiliert.
Es gibt Unterschiede. So gelten im Osten des Landes nicht mehr als durchschnittlich rund 30 Prozent als religiös, im Westen sind es knapp 80 Prozent. Insgesamt glauben etwas weniger als zwei Drittel an die Existenz eines göttlichen Wesens, 70 Prozent betrachten sich irgendwie als religiös, ein Viertel davon sogar als sehr religiös. Für 15 Millionen Menschen in Deutschland spielt also die Religion eine lebensprägende Rolle. Bemerkenswert ist hier, dass von den rund dreieinhalb Millionen Muslime in Deutschland 90 Prozent religiös sind, davon die Hälfte sogar hochreligiös. Offenbar gibt es hier eine stärkere Bindung an das, was vergleichbar bei den Christen an Bindungskraft verloren hat. Die hohe Religiosität, die man allgemein beobachtet, mündet jedenfalls nicht automatisch in einer bleibenden oder gar wachsenden Kirchlichkeit. Im Gegenteil. Das C scheint seine konkrete Verbindlichkeit ein wenig zu verlieren. Jedenfalls im Blick auf die Kirchen, mit denen weithin das C verbunden wird. Zwar sind die Katholiken in Deutschland heute konfessionell gesehen eine Mehrheit von 25,7 Millionen. Doch es gibt nach wie vor hohe Austrittszahlen, und wenn die Prognosen mancher Experten stimmen, dann wird der Mitgliederschwund in den kommenden fünfzehn Jahren weitere fünfzehn oder gar mehr Prozent betragen. Religion ja, Kirche eher nein – so sieht es vielfach aus.
Deutschland ist anders
Man muss eben auch diese Realität im Blick haben, wenn man über das Kreuz mit dem C nachdenkt und eine Antwort auf die Frage nach der Christlichkeit der Union sucht. Es ist eben nicht so simpel, wie viele meinen. Auch Peter Ramsauer, der CSU-Landesgruppenchef in Berlin, weiß das. Und plädiert – wie viele andere auch – für Fairness. Das eine stimmt eben genauso wenig wie das andere, meint er: Die klagende Behauptung aus konservativen Kirchenkreisen, dass christliche Überzeugungen keine Rolle mehr in Deutschland spielten – wie auch zumeist aus derselben Ecke die selbst definierte Berechtigung, der Union den Anspruch zum Führen des C in einer säkularisierten Gesellschaft abzusprechen. Beides sei Unsinn. Beides sei falsch. Enttäuschten Traditionalisten fehle gelegentlich ebenso wie vielen Kritikern das Gespür dafür, wie lebendig christliche Überzeugungen nach wie vor in Deutschland seien, wenngleich sich auch vieles heute anders ausdrücke. Den Wandel müssten Politiker nicht nur sehen, sondern auch berücksichtigen.
Zu diesem Wandel gehört auch eine Erkenntnis, die der CDU-Mann Hermann Kues im Jahr 2008 in einer theologischen Fachzeitschrift formulierte. Bestimmte Selbstverständlichkeiten seien verloren gegangen, denn die Union werde nicht mehr wie früher trotz ihres ökumenischen Charakters vor allem als Partei katholischer Christen verstanden. Der Katholik Kues sieht – auf einen möglichen Katholischen Arbeitskreis in der Union angesprochen – gleichwohl hier keinen wirklichen Bedarf und meint, ein solcher Kreis müsse ja erst einmal bestimmen, was denn das Katholische ausmacht. Das sei gar nicht so leicht – liest man, und wundert sich, wo doch eine solche Bestimmung im evangelischen Bereich trotz der dort gegebenen Vielfalt und Unterschiedlichkeit offenbar vor vielen Jahrzehnten kein wirkliches Problem gewesen zu sein scheint. Der Befragte wiegelt lieber ab und lenkt in eine Ecke. Wenn es sich bei einem solchen Arbeitskreis lediglich um ein Bündnis derer handeln würde, die traurig darüber sind, dass bestimmte Traditionen nicht mehr funktionieren, dann wäre eine solche Plattform nicht zukunftsfähig. Aber nach einer solch engstirnigen Gruppierung war der Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär gar nicht gefragt worden. Erstaunlich, dass da offenbar eine regelrechte Angst subkutan vorhanden ist! Denn viele keineswegs engstirnige und rückwärtsgewandte Katholiken wüssten schon gerne, wo denn ihre durchaus weltoffene Stimme in der Union von heute und morgen eine Stimme haben könnte.
Gespräche wie die mit Hermann Kues sind symptomatisch. Sie zeigen einerseits ein Ringen mit dem C, andererseits eine gewisse Unsicherheit, Profilträgern des C eine wirkliche Chance zu geben. Es gibt in der Union so etwas wie die Furcht vor dem C. Es gibt so etwas wie die Angst vor dem Verlust der eigenen uneingeschränkten Deutungshoheit. Es ist und klingt vor allem richtig, wenn C-Politiker fordern, man solle das C nicht wie eine Monstranz vor sich hertragen, weil das niemanden wirklich überzeuge. Es ist ja ebenfalls richtig, dass früher selbstverständliche Verbindungsund Karrierelinien von der konfessionell gebundenen Jugend bis hin in die Verantwortungsebene der Union heute weggebrochen sind. Und es ist nicht zu bestreiten, dass die einst funktionierende Partnerschaft zwischen der Soziallehre der Kirche und der Union Macken bekommen hat.
Feierliche Beschwörung des C
Vieles ist schwieriger, komplexer und pluraler geworden. Das Dominikanerkloster Walberberg bei Bonn gibt es nicht mehr. Die enge Beziehung in den Kinderjahren der Republik von hier aus nach Bonn und umgekehrt ist Geschichte. Was einmal mit kirchlicher Unterstützung etwa 1957 im Blick auf die dynamische Rente entstehen konnte, kann heute weder vom Verfahren noch von der Sache so einfach kopiert werden. Und wenn C-Politiker heute mit kritischem Unterton anmerken, dass die Soziallehre sich auch viel zu wenig mit alltagstauglichen Überlegungen beschäftige, wenn sie von ihr fordern, sie müsste Überlegungen dazu anstellen, wie der Sozialstaat künftig aussehen könnte – vor allem hinsichtlich des Verhältnisses von Individualismus, Staat und Gesellschaft, dann, ja dann schieben sie den Schwarzen Peter allzu einfach von sich weg und suchen Schuld für ein gestörtes Verhältnis dort, wo diese Schuld sicher nicht ursächlich anzusiedeln ist.
Ich will zitieren, was Hermann Kues in der Herder-Korrespondenz im Herbst 2008 zum C sagte, weil es deutlich macht, wie sehr dies ein Thema ist – oder auch nicht. Auf die Frage, ob sich die CDU nicht gerne grundsätzlich mit der Herausforderung des C im Parteinamen befasse und eher dieses Erbstück als gegeben hinnehme, lautet die Antwort: „Die CDU ist auch immer eine sehr pragmatische Partei gewesen, die Dinge konkret umgesetzt hat. Aus dem christlichen Menschenbild lassen sich bestimmte soziale Verpflichtungen ableiten, gleichzeitig auch die Berufung des Menschen zur Freiheit. Das muss sich beides in praktischer Politik niederschlagen. Wenn die CDU etwa nicht sozial sensibel ist, verliert sie schnell Wahlen. (...) Hinter jeder politischen Entscheidung steckt ja letztlich ein bestimmtes Bild vom Menschen und der Gesellschaft. (...) Das C ist schließlich der Markenkern der Union. Solange sie mit dem C im Namen operiert, muss sie es auch immer wieder deuten, an die praktische Politik rückkoppeln und es begründen. (...) Die CDU würde ohne das C ihre Identität verlieren.“
Große Worte eines engagierten Politikers und eines überzeugten Christen. Bloß: Könnte vieles von diesem Bekenntnis – mit Ausnahme der Markierung des Markenkerns – nicht auch von einem engagierten Politiker manch anderer Parteien ebenso überzeugend gesagt werden? Viele fragen doch nicht nur theoretisch, wo denn der Unterschied der C-Parteien in der pragmatischen Politik zu anderen ist. Und was bitte macht denn die Identität der Union aus, die sie verlieren könnte, wenn es das edle Erbstück nicht mehr gäbe? Freiheit, Menschenbild, Verantwortung, soziale Gerechtigkeit, Werte, Demokratie – sind das heute (noch) exklusive Bestandteile des Profils einer C-Partei? Wo ist denn wirklich der Unterschied zur FDP oder zur SPD? Letztere operiert auch gerne mit dem Begriff des christlichen Menschenbildes. Wo ist zum Beispiel der identitätsstiftende Unterschied in der Stammzelldebatte erkennbar geworden? Wo wird er sichtbar in der Frage der Spätabtreibungen? Wo in der Debatte über Patientenverfügungen? Wo war er denn bei der Neuregelung des § 218 nach dem Fall der Mauer, als man einen Kompromiss suchte zwischen dem Recht auf Tötung noch nicht geborener Menschen und dem Anspruch der Unantastbarkeit der im Bonner Grundgesetz deklarierten Menschenwürde?
| Offene Fragen Wie prägend ist Berlin?Was sind feierliche Beschwörungen des C wert?Wer weiß noch in der Union, was das C bedeutet? |
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+20
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе