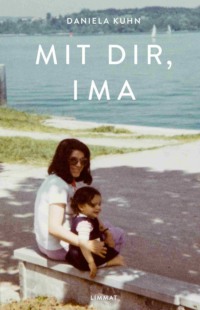Читать книгу: «Mit dir, Ima», страница 3
Im Alltag hingegen war Geld kein Thema. Egal was mein Vater anschaffte, sei es für sich selbst, für mich oder meine Mutter, immer entschied er sich für die beste Qualität. Meine Mutter tat es ihm gleich und ich natürlich auch. Einem grosszügigeren Menschen als meinem Vater bin ich nie begegnet. Mit grösster Selbstverständlichkeit überliess er seiner Frau eine Kreditkarte, auf der sein Titel vermerkt war, sodass die Verkäuferinnen sie mit «Frau Doktor» ansprachen. Bei Weinberg an der Bahnhofstrasse kaufte sie einen schottischen Kaschmirpullover in vier verschiedenen Farben. Den pinkfarbenen, den einzigen, der über vier Jahrzehnte überlebt hat, trage ich noch immer, mit roten Flicken an den Ellbogen. In einer manischen Phase gab meine Mutter im Kleidergeschäft an einem Nachmittag einmal über dreissigtausend Franken aus. Mein Vater bat um eine Zahlung in Raten.
Heute lebt meine Mutter mit sehr wenig Geld. Seit vielen Jahren kauft sie ihre Kleider am Stadtrand im Secondhandladen der WIZO, der Women’s International Zionist Organisation. Ihr Einbauschrank im Altersheim ist voll von Deuxpièces und Blusen im Chanelstil, die sie für wenige Franken erstanden hat. Sie beklagt sich nie, kein Geld zu haben, sie sagt: «Ich finde immer etwas Passendes!»
*
Vor vierzehn Jahren erzählte mir meine Mutter zum ersten Mal, ihr Neffe Yair befehle ihr, nicht zu lesen und zu schreiben, sondern sich ums Essen zu kümmern. Sie hatte sich damals widersetzt und sich sogar einen ganzen Karton voll hebräischer Bücher gekauft. Sie kämpfte mit Yair. «Aber dann habe ich einfach keine Kraft mehr gehabt», sagte sie, «ich habe nachgegeben und angefangen, Kartoffeln, Karotten und Bohnen zu kochen.»
Zwei Jahre später starb Yair im Alter von dreissig Jahren bei einem Unfall. Ich habe meinen Cousin, der in Amerika lebte, als erwachsenen Mann nur selten gesehen, aber in meiner Kindheit waren mir meine Tante Chava, ihr Mann und deren drei Kinder nahe gewesen. Die Nachricht von Yairs Tod traf meine Mutter und mich sehr. Es quälten sie auch starke Schuldgefühle, denn als sie sich von ihm bedrängt gefühlt hatte, hatte sie ihn verflucht und ihm sogar den Tod gewünscht.
Ich versicherte ihr, sein Tod habe damit nichts zu tun, aber es gelang mir nicht, sie zu beruhigen. Sie litt auch, weil ihre Schwester nach dem Tod ihres Sohnes während längerer Zeit den Kontakt mit ihr abbrach, denn kurz davor hatte ich ihrem Mann von den Verwünschungen erzählt. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, die beiden Schwestern haben sich beim letzten Besuch meiner Tante in Zürich sogar gesehen. Und wenn ich mit ihr per Skype spreche, erkundigt sie sich nach meiner Mutter.
Ich fragte mich, was es auf sich hat, dass ausgerechnet der erfolgreiche und gut aussehende Yair sie beschäftigt, der ein begnadeter Wissenschaftler und erfolgreicher Mediziner war.
Drei ihrer vier Schwestern haben Söhne. «Wieder eine Darba» – ein Schlag, pflegte im nordirakischen Kirkuk meine Urgrossmutter zu sagen, wenn ein Mädchen auf die Welt gekommen war. Ihre Mutter war von ihrem Mann verlassen worden, nachdem sie drei Töchter und keinen Sohn zur Welt gebracht hatte. Ihre Tochter, meine Grossmutter, konnte weder schreiben noch lesen. Stattdessen hat sie acht Kinder aufgezogen und ihr Leben mit einem Mann verbracht, den sie nicht liebte.
Ich war drei Monate alt, als meine Eltern mit mir das erste Mal nach Israel reisten. Meine Grossmutter habe sich sehr über mich gefreut, erzählte mir meine Mutter. «Sie hat immer gedacht, ich sei krank, weil ich kein Kind hatte.» In den folgenden Jahren besuchten wir die Eltern meiner Mutter jedes Jahr.
An meinen Grossvater erinnere ich mich nicht, er starb, als ich sieben Jahre alt war. Meine Grossmutter sehe ich vor mir als korpulente alte Frau, die über ihrem Kleid immer ein Wolljäckchen trug. Sie hatte ihr Leben lang in der Küche gestanden, und wie bei vielen älteren orientalischen Frauen äusserte sich ihre Zuneigung über das Essen. Mein Vater erzählte mir, als er meine Mutter einst in Haifa besucht habe, habe meine Grossmutter ihm dampfende Suppe aufgetischt. Sie habe sich neben ihn hingesetzt und zugeschaut, wie er ass, wie ihm der Schweiss hinunterrann. Ab und zu hätte sie genickt und gesagt: «Ta’im, ta’im!» – köstlich, köstlich!
Über ihrem weissen Haar, das sie zu einem Zopf flocht, trug meine Grossmutter ein türkisfarbenes Kopftuch. Die Farbe passte zu den Pfefferminzbonbons, die zusammen mit ihrer Handcreme einen süsslichen Geruch verströmten. Ich mochte ihn nicht. Meine Grossmutter schenkte mir Kaugummis und lehrte mich das hebräische Wort dafür. Ich erinnere mich, wie sie die Kirschsteine bei sich zu Hause auf den Steinboden spuckte.
Ihr Hebräisch hatte einen arabischen Akzent. Sie sprach mit meiner Mutter den jüdisch-arabischen Dialekt, der einst in Kirkuk gesprochen wurde, in ihrer Heimatstadt. Meine Mutter antwortete auf Hebräisch, in der neuen Sprache, die in dem neuen Land gesprochen wurde, in dem sie aufgewachsen war. In meiner Kindheit habe ich das Wort «Irak» aus ihrem Munde nie gehört. Es war mein Vater, der das Land erwähnte, wenn auch nur selten. Einmal sagte er zu mir: «Vielleicht sind es deine irakischen Gene, die dich so arbeitsscheu machen, deine Vorfahren haben bestimmt nicht so viel gearbeitet wie die Leute hier.»
Im Frühling 2003 bombardierten die USA den Irak. Plötzlich stand die Stadt, in der meine Grosseltern gelebt haben, im Scheinwerferlicht der Medien, zum ersten Mal sah ich Fotos von Kirkuk. Auf einem feierten kurdische Frauen in Uniform den Fall der Stadt, ihre Gesichter hätten auch die von israelischen Soldatinnen sein können. Ich legte die Zeitungsseiten in ein Mäppchen, ich hatte bereits die Idee, ein Buch über meine Mutter zu schreiben. Als mir im selben Jahr gekündigt wurde, stürzte ich mich in die Arbeit.
Als Erstes befragte ich meine Mutter über ihr Leben. «Ich werde dir alles erzählen», sagte sie. Im Januar 2004 kam sie jeweils um neun Uhr morgens zu mir. Im Jahr zuvor war mein Vater gestorben, wir befanden uns in einer neuen Situation. Ich fühlte mich freier, denn ich war und bin mir nicht sicher, was mein Vater zu meinem Vorhaben meinen würde. Zum ersten Mal sprach meine Mutter mit mir über ihr Leben in Israel. Ich staunte, wie viel sie in den zweiunddreissig Jahren erlebt hatte, bevor sie in die Schweiz gekommen war, wie vieles sie angefangen und wieder abgebrochen hatte. Und so verlief nun auch ihre Erzählung. Sie hörte an einem bestimmten Punkt einfach auf, kurz nach meiner Geburt.
In den Jahren darauf war die Krankheit meiner Mutter heftiger geworden. Über diese akuten Phasen kann sie nicht sprechen, nach einem Klinikaufenthalt sind ihre Wahnvorstellungen tabu. Sie müsste sich und den anderen gegenüber zugeben, krank gewesen zu sein, geisteskrank. Ich glaube, es ist nicht nur Scham, die sie daran hindert, luzide zurückzublicken. Der Blick zurück wäre ein Blick in die Hölle.
Als unsere morgendlichen Gespräche damals endeten, spürte ich, dass ich mich diesem Stoff behutsam nähern musste. Ich war ganz froh, als Nächstes nach Jerusalem zu reisen, um den ältesten Bruder meiner Mutter und ihren einstigen Freund zu treffen.
Zurück in Zürich recherchierte ich weiter. Mit dem Einverständnis meiner Mutter bat ich die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich um ihre Krankengeschichte. Zwischen 1967 und 1997 war sie achtunddreissig Mal in diese Klinik eingewiesen worden, oft gegen ihren Willen. Ich erhielt eine gelbe Kartonmappe mit dreihundertsiebenundsechzig, eng mit Schreibmaschine beschriebenen Seiten. Auf den ersten drei sind alle Aufnahmen und Entlassungen minutiös aufgelistet. Unter «Heimatort» steht «Zürich».
Es wurde Sommer, bis ich die Büchse der Pandora öffnete. Auf der Zinne setzte ich mich mit den Unterlagen an den von der Sonne gebleichten Holztisch. Sogar hier oben, mit Sonnenlicht und Ausblick in die Berge und auf den See, war die Lektüre ein Gang in die Düsternis. Ich hatte das Ausmass der Katastrophe vergessen, ich wusste nicht mehr, wie schrecklich die Abgründe gewesen waren, in die meine Mutter, mein Vater und ich hineingeraten waren, und vor allem, wie oft sich alles wiederholt hat.
Nachdem ich auch die vielen Briefe gelesen hatte, die sich meine Eltern vor ihrer Heirat geschickt haben, begann ich zu schreiben. Während eines Jahres arbeitete ich an der Biografie meiner Mutter. Und dann gab ich auf. Mir dämmerte, dass ich diese Geschichte nicht journalistisch angehen konnte. Ich konnte nicht über meine Mutter schreiben, ohne auch von mir zu sprechen. Bloss wie und was? Ein Freund von K. erschreckte mich mit der Aussage: «Du musst einen Roman daraus machen. Das, was du erzählen willst, muss Literatur sein!» Das Manuskript, das vor mir lag, war höchstens Rohmaterial.
Ein paar Jahre später nahm ich es nochmals in die Hand. Ich versuchte, mich mehr in den Text einzubringen, aber es gelang mir nicht wirklich. Ich verschob das Vorhaben ein weiteres Mal, es kam mir vor wie ein zu hoher Berg, den zu erklimmen mir noch immer die Kraft fehlte. Andere Projekte fielen mir leichter. Ich befragte mir unbekannte Menschen über ihr Leben und hielt ihre Erzählungen in Büchern fest.
Im letzten Sommer beauftragte mich ein Bankier, seine Biografie zu schreiben. Zuvor hatte ich für die Polizei Webseitentexte verfasst. Beide Aufgaben hatten mich in Welten geführt, die mir unbekannt waren, hatten meine finanzielle Situation entspannt. Ich beschloss, für zwei Monate nach Goa zu reisen, und ich dachte: Jetzt, da meine Mutter sich im Altersheim wohlfühlt, da sie so etwas wie ihren Seelenfrieden gefunden hat, ist der Moment gekommen, um den Versuch noch einmal zu wagen.
2
Meine Grossmutter hiess Masal. Der Name bedeutet auf Hebräisch Glück. Weder ihr noch sonst jemandes Geburtsdatum wurde in Kirkuk schriftlich festgehalten, man erinnerte sich höchstens an die Jahreszeit oder an die Nähe eines Festtages. Jona, der älteste Bruder meiner Mutter, erzählte mir, Masal sei etwa sechs Jahre alt gewesen, als ihr Vater starb. Eser Asaria hatte sich entweder das Leben genommen, um nicht in den Ersten Weltkrieg eingezogen zu werden, oder er war als Soldat der türkischen Armee an Typhus gestorben. Meine Mutter berichtete mir die eine Variante, mein Onkel Jona die andere.
Meine Urgrossmutter Rachma musste ihre drei Kinder allein aufziehen. Während sie ihren Sohn Schlomo und ihre Tochter Farha zur Schule schickte, blieb Masal zu Hause. Als sie acht Jahre alt war, begann sie im Geschäft ihres verstorbenen Vaters mitzuhelfen, wo Seidenstoffe verkauft wurden.
Das Vermögen ihres Mannes hatte Rachma dem Mann ihrer Schwester Masuda übergeben müssen. Wäre ihr ältester Sohn schon alt genug gewesen, wäre er der rechtmässige Erbe gewesen. Witwen und Töchter erbten nichts, sie wurden vom männlichen Familienoberhaupt unterhalten, inklusive der Nedunja, der Mitgift, ohne die keine Frau heiraten konnte.
Meine Grossmutter schilderte den Tod ihres Vaters als Vertreibung aus dem Paradies. Sie erzählte später, Masuda habe das ganze Vermögen an sich gerissen. Deren Sohn Daniel hatte ihr gefallen. Sie hatte ihn an den Festtagen jeweils von Weitem beobachtet. Er war ein guter Schüler und hatte teure Schulen besucht. Einen Cousin zu heiraten, wäre unter den Juden von Kirkuk nicht aussergewöhnlich gewesen. Aber Rachma hatte für ihre Tochter einen anderen ausgewählt. Onkel Jona erzählte mir, meine Grossmutter habe «geweint und geweint und sich die Haare vom Kopf gerissen». Aber dann hatten sie geheiratet: Masal Asaria und Jitzchak Gabbai Bet ha-Rosch.
Im selben Jahr brachte Masal ihren ersten Sohn zur Welt. Sie war sechzehn Jahre alt.
Ich kann mir diese Ehe nicht vorstellen. Ich kann mir das Leben in diesem Kirkuk nicht vorstellen.
In der Familie meiner Mutter hat nur Jona, der erste Sohn meiner Grossmutter, der in Kirkuk Nasem geheissen hatte, gerne vom Leben in dieser Stadt erzählt. Als ich mich 2003 für die Geschichte meiner Mutter zu interessieren begann, war er der Einzige, der mit seiner irakischen Herkunft locker umging. Elieser, sein um ein Jahr jüngerer Bruder, war damals schon nicht mehr am Leben, und mit meiner Tante Schulamit habe ich keinen Kontakt.
Die anderen Geschwister mögen sich an Kirkuk nicht erinnern, weil sie zu klein oder noch nicht auf der Welt waren, als meine Grossmutter für einige Jahre dorthin zurückkehrte. Als ich meine Mutter nach der Zeit in Kirkuk befragte, rückte sie mit dem Wenigen heraus, das sie noch wusste. Auf Fotos oder Gegenstände konnte sie dabei nicht zurückgreifen, und bis ich dieses Buch schreiben wollte, war mir die Leerstelle Irak nicht einmal aufgefallen.
Wenn man gezwungen ist, sich die Informationen über das Land, aus dem man angeblich stammt, bei Wikipedia zusammenzusuchen, dann gibt es vermutlich ein Problem, schreibt Alice Zeniter in ihrem Roman, in dem die in Frankreich geborene Autorin ihren algerischen Wurzeln nachgeht. Anhand der Erzählungen aus ihrer Familie und eigenen Recherchen lässt sie eine archaische und patriarchalische Welt aufleben. Ich habe Die Kunst zu verlieren sehr gerne gelesen und dabei viel an meine Mutter gedacht, aber ich würde es nicht wagen, das Leben meiner Vorfahren im Irak so detailliert zu schildern. Es haben sich bei mir keine Bilder aus dieser Zeit eingestellt; was mir erzählt wurde, blieb seltsam diffus, als könnte die Geschichte in Wirklichkeit ganz anders gewesen sein.
Als ich Anfang der Neunzigerjahre vier Jahre lang in Israel lebte, interessierte sich keiner meiner Cousins für das einstige Leben im Irak. Nichts war ihnen ferner als diese unerfreuliche Vergangenheit. Die meisten hatten selbst schon Kinder, für sie gab es nur Gegenwart und Zukunft.
Selbst in den Irak zu reisen war für mich angesichts der ständigen Kriege in der Region nie eine Option, und da Anfang der Fünfzigerjahre so gut wie alle irakischen Juden nach Israel ausgewandert sind, hätte ich von der Lebenswelt meiner Grosseltern auch nichts mehr angetroffen. Ich stelle mir vor, das Einzige, was unverändert geblieben ist, sind die umliegende Wüste, die Ölfelder und der breite Fluss.
«Ich würde sofort hingehen, wenn ich könnte», sagte Jona, als ich ihn 2004 in Jerusalem besuchte. «Es ist doch interessant, woher man kommt. Aber mit einem israelischen Pass kannst du es vergessen.» Jona erzählte, mein Grossvater Jitzchak habe schon am Anfang seiner Ehe Mühe gehabt, seine Familie zu ernähren. Onkel Schlomo, der Bruder meiner Grossmutter, habe seinen Eltern damals helfen wollen. Als Vorsteher der Eisenbahnstation von Diwaniyya, einer Stadt südlich von Bagdad, habe er für meinen Grossvater einen englischen Wagen und vier Pferde bestellt. Jitzchak habe begonnen, als Kutscher zu arbeiten. «Aber oj», meinte Jona, und über seinem Gesicht breitete sich sein schelmisches Lachen aus, «er war es sich nicht gewohnt, streng und viel zu arbeiten. Onkel Schlomo musste Wagen und Pferde mit Verlust weiterverkaufen.»
Wie ist es möglich, dass ein junger Vater seine Frau, zwei Buben und ein Töchterchen klammheimlich verlässt? Dass er wenige Tage vor Pessach zu seiner Frau sagt, er gehe im nächsten Dorf Essen kaufen und stattdessen einfach das Weite sucht?
Sowohl Jona als auch meine Mutter berichteten, Jitzchak habe genau das getan. Er habe sich 1931 hinter dem Rücken seiner Frau bei der Iraq Petroleum Company anstellen lassen, die damals eine Pipeline von Kirkuk nach Haifa baute. Er habe die Wüste durchquert und sei auf diese Weise nach Palästina gelangt, von wo er eine Postkarte geschickt habe, die nach zwei Monaten in Kirkuk angekommen sei.
Die Geschichte klingt in meinen Ohren fast unglaublich. Aber es war offenbar so: Masal stand mit ihren zwei Buben, Nasem und Adib, und dem Töchterchen allein da – die beiden Zwillinge, die vor Salima auf die Welt gekommen waren, waren bei der Geburt gestorben. Jona meinte, sein Vater habe den feindseligen Alltag mit seiner Frau nicht länger ertragen, deshalb sei er nach Palästina gegangen. Zu Beginn der Dreissigerjahre war dies ein sehr ungewöhnlicher Schritt. «Die irakischen Juden träumten von Eretz Israel, aber sie blieben, wo sie waren. Sie hatten keinen Grund, ihre Häuser, ihr Hab und Gut aufzugeben. Palästina war ein steiniges, trockenes Land, ohne Öl, ohne Wasser, ohne Datteln.»
Masal zog mit den Kindern zu ihrem Bruder. Den ersten Postkarten waren weitere gefolgt, in denen Jitzchak schrieb, er habe im jüdischen Viertel von Haifa ein Zimmer gemietet. Er schickte sogar ein wenig Geld. Ein Jahr verging.
Als ihre Schwester in Bagdad heiratete, nahm Masal mit den Kindern den Zug Richtung Süden. Fast ein Jahr blieben sie bei Farha in ihrem vornehmen Haus. Eines Tages, erzählte Jona, sei seiner Mutter zu Ohren gekommen, ihr Mann habe in Haifa eine kurdische Freundin. Eine verlassene oder gar geschiedene Frau hatte keinerlei Chancen, nochmals einen Mann zu finden, der sie und ihre Kinder ernähren würde. «Ihr war nichts anders übrig geblieben, als ihm nachzureisen.»
Die jüdischen Einwanderer aus Europa, die nach Palästina gelangten, hatten im Irak inzwischen zu nationalistisch-antizionistischen Gesetzen geführt. Die irakische Regierung solidarisierte sich mit der arabischen Bevölkerung Palästinas, irakische Juden konnten nicht mehr legal nach Palästina reisen.
Im Herbst 1933 gelang es Masal, einen Passierschein für den Libanon zu erhalten. Sie fuhr mit dem Bus nach Beirut und heuerte dort einen Schlepper an, der sie, die Kinder und ein paar Juden aus Teheran mit einem Boot von Sidon nach Haifa brachte. Jona, der damals sieben Jahre alt war, erzählte mir vom Scheinwerferlicht der britischen Wächter, das den Schlepper zweimal gezwungen habe umzukehren, erst in der dritten Nacht seien sie in Haifa angekommen.
Falls sich Masal in Palästina ein besseres Leben erhofft hatte, wurde sie enttäuscht. Die vierzig Grusch, die ihr Mann hier als Maurer verdiente, gingen für die Miete des Zimmers weg. Jona erinnerte sich an diese ersten Jahre in Haifa. Die Küche war winzig, die Toilette lag hinter dem Haus.
*
Am 8. November 1935, am vierten Tag von Chanukka, brachte Masal ihr viertes Kind zur Welt: Jehudit – meine Mutter. Wenn stimmt, was sie und mein Onkel mir berichteten, trug die kurdische Freundin von Jitzchak denselben Namen. Ich weiss nicht, wann und ob sie aus seinem Leben verschwunden ist.
Die älteren Geschwister erzählten oft, ihr Vater sei stolz gewesen auf die kleine Jehudit. Er habe einen Kinderwagen gekauft und sei am Schabbat mit allen vier Kindern spazieren gegangen, mal nach Bat Galim, mal zum Technion.
Jitzchak war ein heiterer Typ. Er sah gut aus und hatte Charme. Was den Lebensunterhalt betrifft, nützte ihm beides wenig. Er war oft arbeitslos und musste um Anstellungen betteln. Während den Sommerferien half ihm Nasem, den Wagen zu ziehen, auf dem die Zementsäcke gestapelt waren, die er in den vierten Stock schleppen musste. Die Einsätze waren nie von langer Dauer, mal verkaufte er Maiskolben, mal arbeitete er als Maurer. Und fast genauso oft wechselten die Adressen, an denen die Familie in schäbigen Zimmern wohnte. Etwa an der Rechov ha-Schomer, wo nur eine Strasse weiter unten das arabische Viertel begann. Masal verabscheute diese heruntergekommene Gegend. Haifa war ihr fremd.
Ich besitze ein Familienporträt, das meine Grosseltern damals bei einem Fotografen machen liessen. In der Bildmitte ist Masal, auf ihrem Schoss sitzt meine Mutter. Die fünf Monate alte Jehudit blickt mit weit geöffneten dunklen Augen in die Kamera, sie hat dichtes dunkles Haar. Ich habe ihr in diesem Alter ähnlich gesehen. Der Zweitälteste, Adib, steht neben der Mutter. Mit seinen acht Jahren schaut er sehr ernst, fast traurig in die Kamera; Nasem, der vor ihm sitzt, wirkt offener. Beide Buben tragen einen Pullover mit Reissverschluss und eine Baskenmütze. Am linken Bildrand sieht man Jitzchak. Er hat die Beine übereinandergeschlagen und wirkt mit gestreifter Krawatte, weissem Hemd und dunklem Kittel elegant. Sein dunkles Haar ist mit Pomade nach hinten gekämmt. Er hat eine Hand um die Schulter der fünfjährigen Salima gelegt, die sich an ihn schmiegt und ein Spielzeug hält. Auch sie schaut sehr ernst. Auf dem Bild fällt mir die Distanz zwischen Jitzchak und Masal auf. Mein Blick wandert immer wieder zu ihr. Sie trägt ein weites, fein gemustertes Kleid, dessen Ärmel über die Ellbogen reichen. Ihr schwarzes Haar hat sie zu zwei Zöpfen geflochten, die nach hinten fallen. Die Augen in ihrem schmalen Gesicht schauen ins Leere.
1936 begann sich die arabische Bevölkerung Palästinas gegen die Einwanderung aus Europa zu wehren, die Zustände waren chaotisch. Masal hörte fast jeden Tag von arabischen Gruppen, die gegen Zionisten und Briten kämpften. In Haifa war die Altstadt für Juden gefährlich.
Gebaut wurde kaum, und die Gewerkschaft verteilte die wenigen Jobs nach bestimmten Regeln: Wer vier Kinder hatte, erhielt Arbeit für ein paar Stunden, wer mehr Kinder hatte, erhielt alle zwei Wochen Arbeit für drei Tage. Nasem verkaufte freitags nach der Schule Blumensträusse und brachte der Mutter zehn Grusch.
Masal litt unter der Armut. Sie träumte davon, auf dem Karmel zu wohnen, auf dem Hügel, auf dem das wohlhabende, europäisch geprägte Quartier von Haifa liegt. Eines Tages wickelte sie ihren verbliebenen Schmuck in ein Tuch und ging damit zu einem Makler. Sie kaufte ein Stück Land auf dem Karmel, das nicht allzu teuer war, weil es neben dem Elektrizitätswerk lag. Als Jitzchak davon erfuhr, wurde er wütend. Er suchte den Makler auf und machte den Kauf rückgängig. Streit zwischen den Eltern war an der Tagesordnung. Die Tobsuchtsanfälle des Vaters verängstigten die Kinder, im Zorn warf er einmal alles auf den Boden, sämtliche Teller, Schüsseln und das ganze Essen.
1937 brachte Masal ihr fünftes Kind zur Welt. Das Mädchen wurde Victoria genannt, nach der englischen Königin, die Jitzchak bewunderte, ihr Poträt hing hoch über seinem Bett. Die Jewish Agency arbeitete eng mit der britischen Verwaltung zusammen, die Polizei rekrutierte Tausende von Juden, und die zionistische Untergrundorganisation Haganah gewann an Schlagkraft. Im Juli 1938 tötete eine Bombe der jüdischen Terrororganisation Irgun auf dem arabischen Markt von Haifa einundzwanzig Menschen.
Ihre Eltern hätten täglich von Angriffen auf jüdische Siedlungen gehört, erzählt meine Mutter. «Ich war noch ein Kleinkind, als sie mich eines Tages nicht mehr fanden. Alle gerieten in grosse Aufregung. Es war früher Abend und seit dem Mittag war ich verschwunden. Meine Eltern, meine Geschwister und Araberinnen aus der Nachbarschaft zogen aus, um mich zu suchen. Irgendwann kehrte meine Mutter mit mir an der Hand zurück. Sie hatte mich auf einer Wiese gefunden, weinend, mit Bonbons und einer Puppe in den Händen. Ich wäre beinahe von Arabern entführt worden.»
Masal war fromm. Sie ging zwar nicht in die Synagoge, aber zu Hause erfüllte sie die religiösen Pflichten. Als ältere Frau trug sie auch ein Kopftuch. Die Unstimmigkeiten zwischen ihr und ihrem Mann hatten oft damit zu tun, dass Jitzchak das Judentum nicht sonderlich wichtig war. Er fand seinen Trost im Anisschnaps. Am Schabbatabend trank er Arrak, und nicht wenig.
Einmal, so erzählte mir Jona, ging er an einem solchen Abend zur Gewerkschaft Histadrut. Als deren Sekretär erklärte, es gäbe diese Woche keine Arbeit, warf Jitzchak den Tisch um und tobte so lange, bis die Polizei kam. Er sei ohne Strafe davongekommen, weil er betrunken gewesen sei, erzählte Jona. Kurz darauf habe er dann bei einem Bauführer Arbeit erhalten. «Vierzig Grusch am Tag, vermittelt von der Histadrut. Während er bei Schulmann and Frenkel arbeitete, wurde die Stimmung bei uns immer schlechter. Mutter sehnte sich nach ihrem Bruder, ihrer Schwester, ihrer Mutter und irgendwann hatte sie die Idee, nach Kirkuk zurückzukehren. Aber wie? In diesen Wochen besuchte uns ein Verwandter aus dem Irak. ‹Ma ba’aja?›, fragte er, ‹wo liegt das Problem? Du brauchst nur den Pass, mit dem du gekommen bist.› Er nahm Mutter mit auf das irakische Konsulat in der Altstadt. Sie war entschieden. Vater auch. Er blieb in Haifa, er war absolut gegen einen Besuch in Kirkuk, und auch wir Kinder wollten nicht dorthin.»
Anfang April 1939 bestieg Masal mit fünf Kindern den Zug nach Damaskus. Hier ging es vorerst nicht weiter, denn am Tag nach ihrer Ankunft war der irakische König Ghazi I. tödlich verunfallt. Erst nach der zehntägigen Trauerzeit, in der alles stillstand, konnten sie den Bus nach Bagdad nehmen. Nasem blieb dort bei ihrer Schwester Farha, das restliche Grüppchen fuhr weiter nach Kirkuk.
Für sie habe es in ihrer Kindheit nur eine schreckliche Zeit gegeben, erzählt meine Mutter: die fünf Jahre in Kirkuk. Vom vierten bis zum neunten Lebensjahr lebte sie in dieser Stadt. Nie, kein einziges Mal hat sie von sich aus eine Begebenheit aus Kirkuk erwähnt. Sie hat diese Zeit aus ihrer Erinnerung verbannt und konnte mir nur ein paar wenige, wenn auch sehr prägende Ereignisse erzählen.
Die beiden Zimmer, in denen Masal mit den Kindern wohnte, waren an das grosse Haus ihres Bruders Schlomo angebaut. Im dritten Zimmer wohnte ein alter Junggeselle. Die Kinder schliefen auf dem Boden, ausser ein paar mit Stoff ausgekleideten Truhen und dem Metallbett, auf dem Masal schlief, gab es keine Möbel. Die Küche lag im mit Tonplatten gepflasterten Hof. Sie bestand im Wesentlichen aus einem Lehmofen. Daneben befand sich der Waschraum, wo nur kaltes Wasser aus dem Hahn floss. Auf dem Lehmdach wuchsen im Winter wilde Blumen und andere Pflanzen.
Mit dem wenigen Geld, das Masal hatte, konnte sie hier mehr kaufen als in Haifa, ein Dinar reichte für den ganzen Monat. Sie mischte Sesampaste oder Haferbrei mit Dattelsirup, was Jehudit besonders gerne ass. Einmal im Monat besuchte sie mit den Mädchen den türkischen Hamam, dort sahen sie sie mit offenem Haar.
«Kirkuk ist die Stadt des Öls», erzählte Jona. «Wer nachts mit dem Zug auf die Stadt zufuhr, sah als Erstes die lodernden Felder. Ansonsten hat die Stadt nichts zu bieten, die einzige Sehenswürdigkeit ist die auf einem Hügel gelegene Zitadelle mit dem Grab des Propheten Daniel.»
Eines Tages, so erzählt meine Mutter, habe ihre Mutter sie bei der Hand genommen und diesen Ort aufgesucht, an dem der Prophet vor über zweitausend Jahren gelebt haben soll – auch andere Städte beanspruchen für sich sein Grab. Eine Eisentreppe habe auf einen kleinen, mit grünem Samt überzogenen Turm geführt, von dem aus sie hinunter in die Ebene geblickt hätten. Plötzlich habe der Turm geschwankt. Ihre Mutter sei ganz ruhig geblieben und habe gesagt: «Hab keine Angst, das ist der Geist des Propheten Daniel.»
Jehudit vermisste in Kirkuk ihren Vater. Obwohl er oft arbeitslos war und trank, war er es gewesen, der die Kinder aufgeheitert hatte. Er war ein stolzer und zärtlicher Vater, besonders mit ihr. Seine Witze verstand sie nicht, aber sie liebte den Schalk in seinen Augen, sie genoss es, wenn alle lachten. Ohne Abui war ihr Leben ernst geworden. Und eintönig.
Masals Tage bestanden aus Kochen, Waschen und Putzen. Die beiden Söhne gingen in die Schule. Jehudit und Salima waren im Hinterhof sich selbst überlassen. Stundenlang spielten sie mit einer Schnur und zwei Kartonschachteln «Telefon». Von der Stadt und der Umgebung sahen sie nichts. Nur einmal durften die beiden Mädchen auf einen Ausflug mit, den ihr Onkel mit seiner Familie unternahm. Die Wiesen und Wälder seien grüner gewesen als in Haifa, erzählt meine Mutter. Sie habe viele Blumen gesehen und zum ersten Mal im Leben einen Fluss, den El-Chassa, der durch Kirkuk führt. Später sei sie einmal ganz allein zum Wasser hinuntergelaufen und habe zwei Männern beim Schwimmen zugeschaut.
Ein anderes Mal nahm Onkel Schlomo sie mit dem Zug mit nach Diwaniyya. Er besass dort ein zweites Haus, und meine Mutter erinnert sich, wie sie beide auf einer Wiese unter Bäumen sassen und sie sich ein englisches Buch anschaute mit Bildern von fremden Städten.
Seit über zweitausend Jahren lebten Juden im Gebiet des heutigen Irak. Im modernen Staat, der das Osmanische Reich 1918 abgelöst hatte, war die jüdische Elite Bagdads in wichtigen öffentlichen Funktionen. Während des Zweiten Weltkriegs endete die Idylle. Der probritische König war 1941 nach einem Putsch geflohen, die neue Regierung liess sich von Nazideutschland militärisch unterstützen. Die britische Armee beendete den Staatsstreich nach wenigen Wochen. Dafür mussten die irakischen Juden büssen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte erlebten sie ein grosses Pogrom, die Farhud. Im Juni 1941 ermordete in Bagdad ein aufgebrachter Mob innerhalb von zwei Tagen hunderteinundachtzig Juden, verletzte über tausend Menschen, legte Brände, zerstörte die Synagoge, raubte Geschäfte aus und vergewaltigte jüdische Frauen.
Nasem, der auf dem Rückweg nach Kirkuk in Bagdad geblieben war, versteckte sich zusammen mit dem Rest der Familie bei arabischen Nachbarn.
Noch vor diesem Ereignis war Jitzchak eines Tages mit Hut und elegantem Trenchcoat vor der Tür seiner Frau in Kirkuk gestanden. Zwei Jahre waren vergangen, während derer Jehudit ihren Vater vermisst hatte, eine Ewigkeit ohne ein einziges Telefongespräch, ohne ein Foto. Ich stelle mir den Moment des Wiedersehens vor, die lachenden Augen Jitzchaks. Mein verstorbener Cousin Yair, dessen Stimme meine Mutter immer wieder hört, hat ihm sehr ähnlich gesehen.
Onkel Schlomo liess das Himmelbett aus Nussbaumholz, das meine Grosseltern zurückgelassen hatten, auf das Hausdach stellen. Die Kinder standen darum herum und bewunderten die geschnitzten Rosen. Jitzchak schickte Jehudit und Salima in die jüdische Mädchenschule. Da der Direktor Franzose war, wurde neben Arabisch und Hebräisch auch Französisch unterrichtet. Je veux aller me promener ist der einzige Satz, der meiner Mutter geblieben ist. Sie und ihre Schwester hätten sich damals dagegen gesträubt, Arabisch zu lernen, erzählt meine Mutter, und sie erinnert sich, in ihr Heft ein Hakenkreuz gezeichnet zu haben. Die jüdische Mädchenschule wurde wenig später geschlossen und Jehudit und ihre Schwester verbrachten die Tage wieder zu Hause.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+71
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе