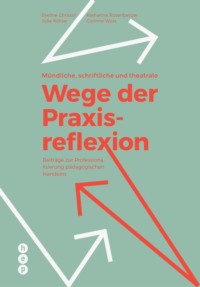Читать книгу: «Mündliche, schriftliche und theatrale Wege der Praxisreflexion (E-Book)», страница 3

Abbildung 3 Vierschrittiges Verfahren zur Analyse von Unterrichtsvideos (Biaggi u. a. 2013, S. 28)
Im ersten Schritt wird zunächst die Situation geklärt, und es werden die konkreten Unterrichtsinhalte und Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler erläutert. Der Unterrichtsausschnitt soll hier eingebettet und beschrieben und die Lernziele und intendierten Lernzuwächse sollen formuliert werden. In Bezug auf die Schülerinnen und Schüler soll geklärt werden, welches Vorwissen notwendig ist und welche möglichen Schwierigkeiten oder besonderen Herausforderungen entstehen könnten.
Der zweite Schritt soll zu einem Perspektivenwechsel anregen und dazu auffordern, das Verhalten der Lernenden im Unterrichtsvideo genau zu beobachten, zu beschreiben und darauf aufbauend Hypothesen zu Verstehensprozessen und Emotionen der Lernenden zu überlegen und zu begründen.
Im dritten Schritt werden die Handlungen der Lehrperson und deren Wirkung auf die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler fokussiert. Es sollen vermutete Zusammenhänge zwischen den Handlungen der Lehrperson und dem Lernen der Schülerinnen und Schüler formuliert und anhand von theoretischem Wissen über Merkmale lernwirksamen Unterrichts begründet werden.
Der vierte und letzte Schritt zielt darauf ab, über alternative Handlungsoptionen und Optimierungsmöglichkeiten nachzudenken. Die Überlegungen sollen begründet und wenn möglich mit theoretischem Wissen über Qualitätsmerkmale des Unterrichts fundiert sein (Biaggi u.a. 2013, S.28 ff.).
Durch das beschriebene Verfahren kann erreicht werden, dass unterschiedliche Perspektiven (Lehrer- und Schülerperspektive) berücksichtigt werden und sowohl der Lehr- als auch der Lernprozess beachtet werden. Die Beobachtungen sollen dabei (theoriebasiert) begründet und mögliche Handlungsoptimierungen formuliert werden.
Die Ausführungen machen deutlich, dass sich die hier dargestellte Vorgehensweise an allgemeinen Konzepten der Reflexion orientiert (siehe Abschnitt 2.2). Solche klaren Anweisungen in Bezug auf die Vorgehensweise sowie eindeutige Leitfragen und Aufgabenstellungen können die videobasierte Reflexion unterstützen und sind notwendig, denn «teachers do not necessarily gain new insights about their practice from watching classroom video. To be an effective tool for teacher learning, video must be viewed with a clear purpose in mind» (Borko u.a. 2008, S.419). Sehr empfehlenswert ist außerdem, die videobasierte Reflexion regelmäßig durchzuführen, damit der Umgang mit dem Datenmaterial vertieft und die für die Bearbeitung notwendigen Kompetenzen angeeignet und entwickelt werden können.
Unterrichtsvideos eignen sich auch sehr gut für Arbeiten im kollegialen Setting. Der gegenseitige Austausch und die gemeinsame Reflexion über das eigene oder fremde Unterrichtsgeschehen werden als bedeutend für die Erweiterung und Professionalisierung des eigenen Handelns angesehen (vgl. Krammer u.a. 2008). Das nächste Kapitel geht deshalb genauer darauf ein und gibt theoretische wie empirische Hinweise für dessen praktische Umsetzung.
4Kollegiale, videobasierte Unterrichtsreflexion – ein Einblick in die Praxis
«In baseball and in the classroom, it takes a cooperative effort. Extraordinary achievement comes from a cooperative group, not from the individualistic or competitive efforts of an isolated individual» (Johnson, Johnson 1999, S.67). Der Austausch und die Zusammenarbeit mit Peers werden auf verschiedenen Ebenen als gewinnbringend erachtet. Im Peer-Setting entsteht eine Kommunikations- und Interaktionsstruktur, in der sich mindestens zwei Personen «auf Augenhöhe» begegnen und diesen Raum nutzen können, um Lernprozesse oder -aktivitäten zu vollziehen und zu reflektieren. Vielversprechend sind in diesem Sinne auch Formen der kollegialen Unterrichtsreflexion. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen kann sehr wertvoll sein, indem andere Ansichten und Beobachtungen wie auch theoretisches Wissen und fachliche Erkenntnisse eingebracht werden, die neue Anregungen und Inputs geben können (vgl. Farrell 2004; Zeichner, Liston 1996). Außerdem ermöglicht die Kooperation sozialen Support und Rückhalt, was sich positiv auf das persönliche Wohlbefinden der Lehrpersonen auswirken kann (vgl. Newell 1996).
In Bezug auf die Selbstwahrnehmung ist der Austausch mit anderen Personen hilfreich, um blinde Flecken in der Wahrnehmung von Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen aufzudecken. Mitmenschen erkennen Verhaltensweisen und Merkmale, welche die oder der Betroffene bei sich selbst nicht wahrnimmt. Durch Feedback können solche blinde Flecken verringert und das Selbstbild kann angepasst und erweitert werden: «By decreasing my blind area, I have more of my truth – more of me – available to me» (Luft 1961, S.6).
An der Pädagogischen Hochschule Zürich arbeiteten die Studierenden der Sekundarstufe I im Rahmen des Moduls Unterrichtsqualität (Baer u.a. 2010) über ein Semester hinweg in Peer-Gruppen und beschäftigten sich dabei mit unterschiedlichen theorie- und praxisbezogenen Aufträgen. Ein zentrales Element dieses Moduls ist die Auseinandersetzung mit Unterrichtsvideos. Alle Studierenden arbeiteten im Rahmen des Moduls mit fremden Unterrichtsaufnahmen und machten anschließend Videoaufnahmen des eigenen Unterrichts. In der Peer-Gruppe wurden die eigenen Unterrichtsaufnahmen analysiert und gemeinsam reflektiert. Jeweils die eigene Unterrichtsaufnahme und diejenige der Lernpartnerin oder des Lernpartners wurden strukturiert mithilfe eines Unterrichtbeobachtungsbogens visioniert und analysiert. Auf dieser Grundlage fand anschließend ein Peer-Reflexionsgespräch statt. Die Peer-Reflexionsgespräche einer Modulgruppe mit 19 Studierenden wurden im Frühlingssemester 2014 aufgezeichnet und im Rahmen eines Forschungsprojekts4 ausgewertet. Einige Erkenntnisse dieser Untersuchung sollen die theoretischen Ausführungen in diesem Kapitel ergänzen und dadurch einen konkreten Einblick in die Praxis gewähren.
4.1Arbeit mit eigenen Unterrichtsvideos in der Peer-Gruppe
Die videobasierte Reflexion kann sowohl mit fremden als auch mit eigenen Aufnahmen vorgenommen werden. Verschiedene Studien haben sich in jüngster Zeit damit beschäftigt, die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Lernsettings zu untersuchen. Es hat sich dabei gezeigt, dass die Arbeit mit eigenen Videos im Vergleich zur Arbeit mit fremden Videos als vorteilhaft beurteilt wird. Die Beschäftigung mit eigenen Unterrichtsvideos wird von den Lehrpersonen als motivierender und aktivierender erlebt, als lernwirksamer eingestuft und es wird größere Authentizität wahrgenommen (vgl. Seidel u.a. 2011; Zhang u.a. 2011).
Die Reflexion von eigenen Unterrichtsaufnahmen in der Peer-Gruppe ist demgemäß aus unterschiedlichen Gründen empfehlenswert. In Studien, welche die konkrete Umsetzung solcher kollegialen Settings untersucht haben, wurden allerdings auch verschiedene Schwierigkeiten erkannt. So zeigte sich, dass sich Lehrpersonen bei der Beschäftigung mit eigenen Aufnahmen häufig mit der Bewertung des Unterrichts beschäftigen, dabei hauptsächlich Positives erwähnen und seltener Konsequenzen des Unterrichts oder Handlungsalternativen formulieren (vgl. Seidel u.a. 2011; Krammer, Reusser 2005).
In der eigenen empirischen Untersuchung der Peer-Reflexionsgespräche der Studierenden wurden ähnliche Herausforderungen festgestellt. Die Gespräche wurden unter anderem darauf hin ausgewertet, welche Personen in den Gesprächen im Vordergrund standen. Von den insgesamt 810 Gesprächssequenzen, in denen ein personenbezogener Fokus festgestellt werden konnte, waren 673 (83 %) auf die Lehrperson bezogen und lediglich 119 (14.7 %) beschäftigten sich mit dem Verhalten oder Lernen der Schülerinnen und Schüler. In 18 Gesprächssequenzen (2.2 %) waren Drittpersonen, wie beispielsweise die Praxislehrperson, im Fokus (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4 Gesprächsfokus in den kollegialen Reflexionsgesprächen
Viele Aussagen der Studierenden hatten eine bewertende Funktion. Von den Sinneinheiten, die in den Gesprächen für die Analyse definiert wurden, enthielten 27 Prozent eine Beurteilung. Mehr als zwei Drittel davon (69 %) waren positive Bewertungen. Interessant ist, dass die Rückmeldungen der Peers insgesamt viel mehr beurteilende Aussagen enthalten und sie insbesondere positive Aspekte hervorheben. Während die Studierenden ihren eigenen Unterricht relativ häufig kritisieren (42 % Kritik zu 58 % Lob), wird der Unterricht der Kolleginnen und Kollegen wenig kritisch beurteilt und es werden viel mehr positive Aspekte hervorgehoben (26 % Kritik zu 74 % Lob) (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5 Lob und Kritik des eigenen und kollegialen Unterrichts
Der nachfolgende Ausschnitt aus einem Gespräch zeigt exemplarisch, dass die Studierenden für den Unterricht der Kolleginnen und Kollegen viele lobende Worte finden:
… du hast das sehr gut gemacht mit den Schülern, es hat guter Unterricht stattgefunden, es war strukturiert, du hast gesagt, wo es langgeht. (-) Ähm, du hast die Schüler auch gut gelobt, du hast dreimal «sehr gut» gesagt, «exzellent». Mir ist aufgefallen, dass das gegen Ende der Lektion häufiger aufgetreten ist. Du hast die Schüler dann mehr gelobt. Aber du bist auch gut auf sie eingegangen, hast gesagt, «hey eben, was sonst noch weiter», du hast versucht etwas aus den Schülern herauszuholen. (Reflexionspartner/-in – 15BEE_FS14 / 16:16)
Auch etwas ausführlichere Rückmeldungen zu einem bestimmten Sachverhalt, in denen positive Aspekte hervorgehoben und erläutert werden, sind in den Gesprächen oft vorzufinden:
Und dann auch, was mir noch aufgefallen ist, es hat so Jungs zum Teil, die Jungs haben zum Teil, sind wieder hingesessen und haben wieder so ein bisschen hinten angelehnt und du hast sie immer wieder genommen und gesagt, so aufstehen, kommt, ich habe es euch schon so oft gesagt, los jetzt und so. Und dort eigentlich auch wirklich, weißt du, bestimmt und eigentlich ganz kurz. Du hast dich nicht aus dem Konzept bringen lassen groß und du hast es aber auch=du hast es immer wieder gesagt, dass sie sich so groß, also hinstellen müssen. (Reflexionspartner/-in – 11RBE_FS14 / 8:8)
Solche positiven, unterstützenden Rückmeldungen sind durchaus wertvoll und können das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärken. Für die persönliche und professionelle Weiterentwicklung ist es jedoch wichtig, auch kritische Aspekte anzusprechen und sich über mögliche Handlungsalternativen auszutauschen. Dies scheint (angehenden) Lehrpersonen jedoch schwer zu fallen. Bereits in früheren Studien wurde erkannt, dass sich Lehrpersonen im Rahmen von Peer-Gruppen nur ungern kritisch über die Unterrichtsvideos der Kolleginnen und Kollegen äußern. Aus Höflichkeit und Loyalität gegenüber Kolleginnen und Kollegen werden solche Aspekte nur selten angesprochen (Borko u.a. 2008; van Es 2012; Zhang u.a. 2011).
Dieser Befund bestätigt sich in der eigenen Untersuchung. Wie Abbildung 5 zeigt, äußerten sich die Studierenden nur sehr zurückhaltend kritisch gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen. In zwei der insgesamt neunzehn Gespräche wurden gar keine kritischen Bemerkungen gemacht. In weiteren drei Gesprächen wurde lediglich ein Aspekt des Unterrichts kritisch beurteilt. In den Gesprächen, in denen etwas Kritisches angemerkt wurde, ist zu erkennen, dass es für die Studierenden schwierig war, die richtigen Worte zu finden.
Was mir, also das ist jetzt nicht unbedingt gerade diese Lektion, das war eher bei der schülerzentrierten, aber was vielleicht … ich habe es nicht mehr so im Kopf, vielleicht war es bei dieser auch ein bisschen, du hast ja=bist ja vorbeigegangen oder? Bei den Schülern? Das ist sicher (-) super, oder, dass du jedem irgendwie, kannst jedem irgendwie etwa eine Minute fast, jedem widmen, oder eine halbe Minute. Oder aber, dass dort hatten sie manchmal Fragen, und du hast dort ihnen manchmal schon beinahe die Lösung gesagt. Zum Teil irgendwie (-) wirklich (-) sie dazu hingeführt, dass sie gerade die Lösung wissen, statt irgendwie eine Frage zu stellen, so eine offene, ja was? (Reflexionspartner/in – 04WJP_FS14 / 28:28)
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Unterricht steht in den Gesprächen in Zusammenhang mit dem Formulieren von Handlungsalternativen, denn solche wurden von den Studierenden insbesondere dann gesucht, wenn über weniger gelungene Aspekte des Unterrichts gesprochen wurde. Sich Gedanken über mögliche Handlungsalternativen zu machen ist ein wichtiger Aspekt einer Reflexion, da sie auf das zukünftige Handeln ausgerichtet sind und dadurch Verhaltensänderungen initiieren können (siehe Abschnitt 2.2). Die Arbeit in der Peer-Gruppe kann dies unterstützen. Durch die Außensicht auf das eigene Handeln und Denken kann ein vertieftes Verständnis entstehen und die gemeinsame Diskussion über Handlungsalternativen kann das eigene Handlungsrepertoire erweitern. Es ist deshalb zu erwarten, dass der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen Lernprozesse anregt und die professionelle Entwicklung unterstützt (vgl. Kaasila, Lauriala 2010).
In den meisten Reflexionsgesprächen der angehenden Lehrpersonen wurden Handlungsalternativen erwähnt. In zwei Gesprächen wurde allerdings gar keine Handlungsalternative thematisiert, in zwei weiteren lediglich eine. In diesen Gesprächen wurden auch (fast) keine kritischen Aspekte angesprochen. Damit haben die Studierenden eine wertvolle Chance verpasst, sich mit der Erweiterung des Unterrichtsrepertoires zu beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit Handlungsoptionen dient dazu, neue Konzepte und Ideen zu entwerfen und den Unterricht dadurch zukünftig lebendiger und vielseitiger zu gestalten, und ist damit grundsätzlich wichtig für die berufliche Weiterentwicklung.
Wie Abbildung 6 zeigt, wurden von beiden Gesprächspartnern Handlungsoptionen genannt. Auffallend ist, dass die Peers vergleichsweise häufig Handlungsoptionen nennen, ohne diese zu erklären oder zu begründen.

Abbildung 6 Anzahl Veränderungsvorschläge für den eigenen und den kollegialen Unterricht
In den Gesprächen wurden bis zu zwölf Handlungsalternativen gefunden. Leider wurden diese zumeist jedoch nur sehr oberflächlich erwähnt. Die Vorschläge wurden kaum gemeinsam diskutiert und blieben häufig nur «in den Raum gestellt». Die nachfolgenden zwei Beispiele wurden der Kategorie «Handlungsoption unbegründet» zugeordnet. Sie zeigen exemplarisch, wie und inwiefern über Handlungsalternativen gesprochen wurde.
Und dann habe ich, habe ich noch geschrieben, so ein bisschen Varianten für Rückmeldungen überlegen. Eben so, das hast du, eigentlich hast du das ja schon gemacht, das hast du dann auch schon umgesetzt und äh, ist einfach in dieser Stunde war das natürlich äh recht offensichtlich. Dass man äh da irgendwie noch so etwas dran arbeiten könnte. (Reflexionspartner/-in – 07ZGP_FS14 / 36:36)
Das hätte man vielleicht ein bisschen variieren können, mit=mit äh, ein bisschen mehr Präsenz zeigen. Aber das ist eigentlich das Einzige. (Reflexionspartner/-in – 04UIT_FS14 / 8:8)
Die Handlungsalternativen, die von den Personen begründet wurden (Kategorie «Handlungsoption begründet»), wurden von den Studierenden etwas ausführlicher thematisiert, jedoch blieben die Erklärungen auch hier äußerst knapp und ungenau. So wurden beispielsweise die Überlegungen, die zur Wahl von Handlungsalternativen geführt haben, oder die deren Auswirkungen thematisieren, kaum erwähnt. Die Möglichkeit, verschiedene Handlungsoptionen gegeneinander abzuwägen und deren Vor- und Nachteile zu diskutieren, wurde nicht genutzt, theoretische Begründungen oder Bezüge fehlten gänzlich. Die nachfolgenden Ausschnitte zeigen wiederum zwei konkrete Beispiele.
Ja, ich glaube auch, in einer anderen Lektion, das wäre im Nachhinein vielleicht schon besser gewesen, dass ich das nicht so hineingequetscht hätte, wegen der Zeit. (Person hat unterrichtet – 27WIW_FS14 / 13:13)
Du hast einfach gesagt, nein, und macht das jetzt so. Und da habe ich so gedacht, hm, da hättest du vielleicht sagen können, eigentlich ist das eine mega coole Idee, aber das geht jetzt einfach gerade nicht. [Lachen] Also weißt du so… damit er, weil er saß dann so ein bisschen da, ja okay mmmm … ja und hat dann eben so ein bisschen /gewäffelet5/ vor sich hin noch. Also man hat gemerkt, er war ein bisschen frustriert, dass du da so ein bisschen … ja. Das ist mir einfach so. (Reflexionspartner/-in – 23GHH_FS14 / 64:64)
Die Ausführungen in diesem Kapitel haben auf einige Schwierigkeiten und Herausforderungen hingewiesen, die bei der kollegialen Arbeit mit eigenen Unterrichtsvideos in der Peer-Gruppe in bisherigen Studien gefunden wurden. Das nächste Kapitel schließt hier an und gibt Hinweise, welche Besonderheiten Reflexionsgespräche in der Peer-Gruppe aufweisen und wie sie noch besser angeleitet und unterstützt werden können.
4.2Konstruktive Reflexionsgespräche in der Peer-Gruppe führen
Wenn Lehrpersonen in einer Lektüregruppe gemeinsam über ein Buch diskutieren, ist dies eine ganz andere Situation, als wenn sie in der Peer-Gruppe über den eigenen videografierten Unterricht sprechen. Kolleginnen und Kollegen Einblick in den Unterricht zu gewähren, sich selbst kritisch zu beurteilen, Stärken und Schwächen des Unterrichtsgeschehens zu beleuchten sowie anderen produktive Rückmeldungen zu geben, erfordert Vertrauen in die Gruppengemeinschaft. Damit dies gelingt, braucht es kommunikative Fähigkeiten, längerfristige Zusammenarbeit und das Vermögen, konstruktives Feedback zu geben und anzunehmen.
4.2.1Eine unterstützende Gemeinschaft aufbauen
Damit Unterrichtsentwicklung angeregt wird, braucht es eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Unterricht. Der Austausch mit anderen Personen kann hierzu hilfreich sein, indem neue Inputs eingebracht, eigene blinde Flecken aufgedeckt und Ideen diskutiert werden können. Im Gespräch sollte gemeinsam darüber nachgedacht werden, wie der Unterricht verbessert werden könnte und wie man sich gegenseitig unterstützen kann, damit die Umsetzung im Unterricht auch gelingt. Werden Unterrichtsvideos als Gesprächsgrundlage genutzt, sollte über einen längeren Zeitraum damit gearbeitet werden, damit die Unterrichtsanalyse geübt werden und sich eine konstruktive Gesprächskultur entwickeln kann. Es empfiehlt sich außerdem, vorerst mit Unterrichtsvideos von fremden Personen zu arbeiten, bevor eigene Unterrichtsaufnahmen verwendet werden. Wenn der eigene Unterricht erst selten auf Video betrachtet wurde, ist es hilfreich, sich zuerst damit «anzufreunden» und sich selbst mit der Unterrichtsaufnahme auseinanderzusetzen, bevor das Video in der Gruppe angeschaut wird. Die eigene Stimme und Ausdrucksweise auf Video zu betrachten kann anfänglich ungewohnt und unangenehm sein. Für die Analyse der Unterrichtsvideos ist es notwendig, die Vorgehensweise und Analysekriterien vorzugeben (Hinweise dazu finden sich in Abschnitt 3.4) und anhand von fremden Unterrichtssequenzen einzuüben (vgl. So 2012; Brouwer, Fokelien 2013). Für die gemeinsame Arbeit mit Unterrichtsvideos ist darauf zu achten, dass immer ein respektvoller Umgang gepflegt wird, auch wenn kontroverse Diskussionen geführt werden (vgl. Farrell 2004). Hierfür sollten vorgängig Gesprächsnormen festgelegt werden und die Dozierenden sollten die Gespräche am Anfang leiten und begleiten:
To foster such conversations, professional development leaders should help teachers to establish trust, develop communication norms that enable challenging discussions about teaching and learning, and maintain a balance between respecting individual community members and critically analyzing issues in their teaching […]. (Borko u. a. 2008, S. 421)
Damit sich gegenseitiges Vertrauen entwickeln kann, ist es von Vorteil, wenn Lerngruppen längerfristig zusammenarbeiten.
Das Ziel von Reflexionsgesprächen soll darin liegen, gemeinsam über die Weiterentwicklung der professionellen Kompetenzen und des Unterrichts nachzudenken. Bei Gesprächen ohne diesen Fokus besteht die Gefahr, dass der Diskurs als Alibi-Übung und, im schlimmsten Fall, als reine Zeitverschwendung aufgefasst wird. Diese Zielsetzung soll klar kommuniziert werden und allen Beteiligten bewusst sein. Es ist nachvollziehbar, dass für die Zielerreichung eine kritische Auseinandersetzung mit dem Unterricht notwendig ist. Dabei ist es hilfreich, produktive Fragen zu stellen und konstruktives Feedback zu formulieren. Beide Aspekte waren in den analysierten Peer-Reflexionsgesprächen der Studierenden wenig ausgeprägt.
4.2.2Fragen gezielt einsetzen
Fragen sind ein wichtiges Hilfsmittel, um das Gegenüber zu Denkprozessen anzuregen. Die Reflexionspartnerinnen und -partner sollten sich dessen bewusst sein und geeignete Fragen gezielt einsetzen, um Reflexionsprozesse zu initiieren. Allgemein bekannt ist die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Fragen. Bei geschlossenen Fragen sind die Antwortmöglichkeiten vorgegeben und das Antwortspektrum ist sehr eingeschränkt. Bedacht eingesetzt können sie jedoch helfen, ein Gespräch zu strukturieren und von der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner eine klare Aussage zu erhalten. Die offenen Fragen werden in Lehr-Lern-Settings als vorteilhaft beurteilt, da sie das Gegenüber dazu verleiten, etwas zu erzählen, zu erläutern oder zu erklären. Offene Fragen werden gemeinhin als W-Fragen bezeichnet, da sie mit einem Fragewort beginnen, das den Anfangsbuchstaben W hat (z.B. «wer», «was», «wozu» usw.).
In den neunzehn Reflexionsgesprächen der Studierenden kamen hauptsächlich Fragen zur Gesprächssteuerung (z.B. «Möchtest du gleich beginnen?») oder zur Verständnisklärung (z.B. «Meinst du auch das?») zum Einsatz. Offene Fragen, die zum Nachdenken und Erläutern anregen, waren nur äußerst selten vorhanden. Eines der wenigen Beispiele ist das folgende:
Vielleicht noch beim Schluss, ähm, was hätte man vielleicht dort noch machen können? Dass die Schüler, die schnell fertig waren …? (Reflexionspartner/-in – 04UIT_FS14 / 26:26)
Für die kollegiale Reflexion von Unterricht können Fragen vorgegeben werden, die die Studierenden als Grundlage für die Gespräche verwenden können (vgl. z.B. Kreis, Staub 2013). Ein solcher Fragenkatalog kann insbesondere für wenig routinierte Gesprächspartnerinnen und -partner eine Gedankenstütze sein.
Anzumerken ist, dass der Einsatz einer guten Fragetechnik bzw. das Verwenden von passenden Fragen für (angehende) Lehrpersonen zum Berufsalltag gehört und in Lehrgesprächen tagtäglich umgesetzt wird, um den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen (vgl. Lipowsky 2009). Daher sollte diese Kompetenz im Rahmen der Aus- und Weiterbildung ganz grundsätzlich gefördert werden. Kollegiale Reflexionsgespräche bieten eine gute Möglichkeit, sich darin zu üben und zu vertiefen.
4.2.3Konstruktives Feedback geben und annehmen
John Hattie hat sich in verschiedenen Arbeiten mit dem Thema Feedback beschäftigt. Eine Kernaussage aus einer seiner Publikationen zeigt deutlich, wie wichtig Feedback für die Unterstützung von Lernprozessen ist: «Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or negative» (Hattie, Timperley 2007, S.81). Aus seinen Studien geht hervor, dass Feedback einen der wichtigsten Einflussfaktoren auf den Lernerfolg darstellt, wobei nicht alle Arten von Feedback gleich wirkungsvoll sind. Konstruktive Rückmeldungen zu Tätigkeiten einer Person und Hinweise, wie diese Tätigkeit noch besser ausgeführt werden könnte, sind besonders wertvoll. Lob, Belohnung oder Bestrafung sind hingegen weniger effektiv (vgl. ebd.).
Für das Formulieren von Feedback findet man in entsprechender Ratgeberliteratur verschiedene Hinweise. In Anlehnung an Hans-Jürgen Kratz (2010, S.34 ff.) sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Konstruktives Feedback …
 … soll so gegeben werden, dass es dem Empfänger bzw. der Empfängerin hilft, sich selbst und seine bzw. ihre Wirkung auf andere zu verstehen.
… soll so gegeben werden, dass es dem Empfänger bzw. der Empfängerin hilft, sich selbst und seine bzw. ihre Wirkung auf andere zu verstehen.
 … soll beschreibend und nicht bewertend oder interpretierend formuliert sein. Konkrete Beobachtungen einbringen, aber keine Schlussfolgerungen oder Urteile.
… soll beschreibend und nicht bewertend oder interpretierend formuliert sein. Konkrete Beobachtungen einbringen, aber keine Schlussfolgerungen oder Urteile.
 … muss sich auf veränderbare Verhaltensweisen beziehen.
… muss sich auf veränderbare Verhaltensweisen beziehen.
 … muss konkret und nicht allgemein abgefasst sein, es sollte also keine pauschalen Aussagen und Bewertungen enthalten.
… muss konkret und nicht allgemein abgefasst sein, es sollte also keine pauschalen Aussagen und Bewertungen enthalten.
 … soll klar und pointiert formuliert sein, nicht verschwommen oder gar vage.
… soll klar und pointiert formuliert sein, nicht verschwommen oder gar vage.
 … darf nur in eigenem Namen gegeben werden, also ichbezogen und nicht indirekt («wir» oder «man»).
… darf nur in eigenem Namen gegeben werden, also ichbezogen und nicht indirekt («wir» oder «man»).
 … sollte nicht mehr Informationen enthalten, als der Feedbackempfänger bzw. die Feedbackempfängerin verarbeiten kann.
… sollte nicht mehr Informationen enthalten, als der Feedbackempfänger bzw. die Feedbackempfängerin verarbeiten kann.
 … wird nicht immer sofort akzeptiert. Die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild kann den Feedbackempfänger bzw. die Feedbackempfängerin im ersten Moment sehr irritieren. Deshalb genügend Zeit lassen, damit das Feedback verarbeitet werden kann.
… wird nicht immer sofort akzeptiert. Die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild kann den Feedbackempfänger bzw. die Feedbackempfängerin im ersten Moment sehr irritieren. Deshalb genügend Zeit lassen, damit das Feedback verarbeitet werden kann.
 … beschränkt sich nicht nur auf Kritikwürdiges, sondern soll auch positive Wahrnehmungen enthalten.
… beschränkt sich nicht nur auf Kritikwürdiges, sondern soll auch positive Wahrnehmungen enthalten.
Nicht nur das Geben, sondern auch das Annehmen von Feedback will gelernt sein. Der Empfänger bzw. die Empfängerin des Feedbacks befindet sich vorerst in einer eher passiven Rolle und muss die kritischen Rückmeldungen der Gesprächspartnerinnen und -partner entgegennehmen. Auch wenn dies als unangenehm empfunden wird, sollte sich der Empfänger bzw. die Empfängerin bewusst sein, dass Feedback immer eine Chance für die persönliche Weiterentwicklung darstellt. Gemäß Hattie (2003) zeichnen sich Experten und Expertinnen dadurch aus, dass sie Feedback vermehrt suchen und besser damit umgehen und es verarbeiten können.
Ein guter Feedbackempfänger bzw. eine gute Feedbackempfängerin sollte …
 … die anderen ausreden lassen und keine vorschnellen Vermutungen darüber anstellen, was das Gegenüber sagen will.
… die anderen ausreden lassen und keine vorschnellen Vermutungen darüber anstellen, was das Gegenüber sagen will.
 … sich nicht rechtfertigen oder verteidigen. Die Meinung der anderen annehmen und versuchen, daraus zu lernen.
… sich nicht rechtfertigen oder verteidigen. Die Meinung der anderen annehmen und versuchen, daraus zu lernen.
 … versuchen zu verstehen, was die oder der andere meint. Sich nicht davor scheuen, Verständnisfragen zu stellen.
… versuchen zu verstehen, was die oder der andere meint. Sich nicht davor scheuen, Verständnisfragen zu stellen.
 … dankbar sein für Feedback, auch wenn es nicht in der richtigen Form gegeben wurde. Aus jeder Art von Feedback kann etwas herausgezogen und gelernt werden. (Vgl. Hochschuldidaktikzentrum der Universitäten des Landes Baden-Württemberg o. J.)
… dankbar sein für Feedback, auch wenn es nicht in der richtigen Form gegeben wurde. Aus jeder Art von Feedback kann etwas herausgezogen und gelernt werden. (Vgl. Hochschuldidaktikzentrum der Universitäten des Landes Baden-Württemberg o. J.)
Wie in Abschnitt 4.1 erläutert, fällt es vielen Studierenden leicht, ihrem Gegenüber eine positive Rückmeldung zu geben. Wenn es jedoch um das Formulieren von konstruktiven Rückmeldungen geht, scheinen sich die meisten Studierenden in der Rolle der Feedbackgeberin bzw. des Feedbackgebers und derjenigen Person, die das Feedback empfängt, nicht so wohl zu fühlen, wie der folgende Gesprächsausschnitt exemplarisch zeigt. Die Aussagen des Feedbackgebers/der Feedbackgeberin sind vage und unklar, der Feedbackempfänger/die Feedbackempfängerin rechtfertigt das eigene Handeln zuerst, nimmt die Kritik dann aber trotzdem an, jedoch ohne darüber nachzudenken, wie die Situation besser hätte gestaltet werden können.
B: … [Lachen, unverständlich] Gegenwartsbezug. Also eben ich meine, das findet ja eigentlich irgendwie überall statt, dass es immer wieder mal=und es war nicht so, dass es groß gestört hat oder groß irgendetwas untergegangen ist, von daher finde ich das ja …
A: Okay, da habe ich auch eher schlecht. Ja das habe ich, Zukunfts- und Gegenwartsbezug habe ich mir selber eigentlich auch aufgeschrieben.
B: Ja da habe ich mir überlegt, ja also ich meine das=wie, das kannst du=wie macht man das da jetzt gerade so, wie möchtest du mit dem? Weil irgendwie ist, ich habe dann nachher überlegt, eigentlich wäre das, irgendwie hast du es ja gegeben durch die Aufführung, oder. Aber sonst halt, du singst halt ein Lied irgendwie, das ist noch schwierig.
A: Ja, also jetzt, ich habe jetzt da in der Lektion auch nicht gesagt, ja wir machen jetzt das … Sie wissen eigentlich, das ist alles für die Aufführung. Und von daher, (-) ich sage es in der Lektion gerade nicht direkt, aber das Ziel ist schon die Aufführung, und von daher hat es für sie einen Zukunftsbezug, wenn sie mal in einer Band spielen, wissen sie wie sie … vorgehen müssen um ein Lied einzuüben oder Gegenwartsbezug … Ja. (-) Ja aber es fehlt schon, in der Lektion selber hat es schon eher gefehlt, sage ich mal. Darum haben wir das beide eher= beide eher negativ.
B: =Ist mir eben, ist mir auch nicht aufgefallen.
(A: Person hat unterrichtet, B: Reflexionspartner/-in – 11RBE_FS14 / 34:38)
Angehende Lehrpersonen müssen sich der Funktion von Feedback bewusst sein und das Geben und Annehmen von konstruktivem Feedback üben und schätzen lernen. Claus G. Buhren (2015) bringt es in Anlehnung an Martin Buber folgendermaßen auf den Punkt:
Ohne Feedback keine Veränderung, keine Entwicklung, kein Wachstum. Der Mensch braucht das ‹Du› […] – als Spiegel, als Resonanzkörper, als Korrektur im Alltag wie im Beruf. Auch wenn Feedback manchmal unliebsam, zuweilen unbequem und nicht immer erwünscht ist, kann man nicht darauf verzichten. (Buhren 2015, S. 29)
Im Berufsalltag geben Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern tagtäglich Feedback und können damit den Lern- und Entwicklungsprozess der Kinder und Jugendlichen unterstützen. Andererseits erhalten Lehrpersonen, gewollt oder ungewollt, von den Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen zum Unterricht; Unterrichtshospitationen von Lehrerkolleginnen und -kollegen, der Schulleitung oder von Schulbehörden mit anschließender Unterrichtsbesprechung sind heute üblich. Mit dem richtigen Bewusstsein für den Wert solcher Rückmeldungen werden Lehrpersonen diese Informationen für die Unterrichtsreflexion und -entwicklung nutzen können.
5Fazit und Empfehlungen für die Praxis
Die Reflexion ist in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen heute ein fester Bestandteil. Damit Reflexionsprozesse wirkungsvoll sein können, muss ein geteiltes Verständnis der Begriffsbestimmung und Zielsetzung vorliegen. Ausgehend von den Ausführungen in diesem Beitrag bildet die folgende Darstellung die zentralen Bereiche und Inhalte einer professionellen Reflexion ab:
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+64
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе