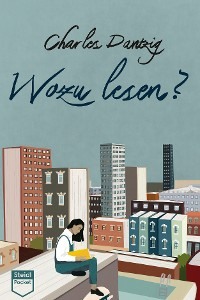Читать книгу: «Wozu lesen? (Steidl Pocket)», страница 3
Die angenommene Passivität des Lesers
Es gibt Momente, in denen es dem Leser durchaus gelegen kommt, sich in einer passiven Rolle zu sehen. Dann nämlich, wenn er von einem Buch nicht begeistert ist. Nur hat man bloß, weil man nicht begeistert ist, nicht unbedingt recht. Der Leser vergisst häufig, wenn er dem Autor etwas vorwirft, dass er möglicherweise selbst Schuld daran trägt. Er kann unter schlechten Voraussetzungen gelesen haben. Schlecht gelaunt gewesen sein. Nicht wirklich gelesen, sondern nur nach der Bestätigung seiner Vorurteile gesucht haben. Doch all das bedenkt er nie. Schuld trägt immer der Autor. Obwohl es durchaus vorkommt, dass dieser gescheiter ist als sein Leser.
Im Allgemeinen wird vorausgesetzt, Leser seien anständige Menschen, alle Leser seien anständige Menschen. Aber auch Idioten lesen. Sie sind das Publikum für Bücher, die behaupten, die Attentate des 11. September 2001 seien von Amerikanern verübt worden. Hohlköpfe. Oder für Bücher, in denen die Gesellschaft des Spektakels niedergeschrien wird, Bücher von Guy Debord. Fieslinge. Oder für Bücher von Louis-Ferdinand Céline. Zyniker. Und dann gibt es noch die Dummen, eine ideale Leserschaft für aggressive Essays von pedantischen Autoren. Doch kehren wir diesen verabscheuungswürdigen Lesern den Rücken, denn über schlechte Menschen kommt man nicht zu guten Gedanken.
Die fügsame Leserin
Magritte wählte für seine Bilder meist erklärende Titel, wie etwa die Fügsame Leserin, die mit ihrer großen Nase und den dicken Augenbrauen der Callas ähnelt und der beim Lesen in einem Buch ein Aufschrei entfährt. Wie würde man Magrittes Bilder interpretieren, hätten sie keine Titel? Wäre die Ironie überhaupt zu erkennen? Und beweist das nicht die Schwäche der Ironie? Gehen wir davon aus, dass der Titel bei Magritte Teil des Bildes ist, weshalb er ihn manchmal sogar direkt auf die Leinwand malt wie bei Ceci n’est pas une pipe. Heute würde Magritte vielleicht Museumsbesucher malen, mit übergestülpten Kopfhörern, die Augen aufgerissen wie die Leserin. Titel des Tableaus (auf die Leinwand gemalt oder nicht): Die Audioguides. Die Audioguides! Die Leute bestehen auf ihre Gedankenlosigkeit. Dabei sind wir nur, während wir lesen, vor der Pädagogik sicher. Die Lektüre kann in eine bestimmte Richtung gelenkt worden sein [vorher] und zu Interpretationen führen [nachher], aber währenddessen ist man auf sich gestellt. Was manchmal einem Kampf gleichkommt: Der Leser gegen das Buch, das ihn irritiert; der Leser gegen sich selbst und sein eigenes Unverständnis. – Bleibt es ein Duell oder wird es zum Duett?
Lesen, um die Buchmitte zu überwinden
Ich lese Der Mann ohne Eigenschaften von Musil. Es ist ein langes Buch. Zwei Bände mit jeweils tausend Seiten. Es hat etwas von einem Kampf, diese Berge zu besteigen. Ah, du glaubst, du kannst mich bezwingen? Langsam, grimmig und mit viel Geduld erklimmt man die erste Hälfte und denkt schon an den Abstieg, der leichter sein wird. Dabei packt einen ein Hochgefühl, in das sich Empörung mischt. Wie unverfroren, so viele Seiten zu veröffentlichen! Was für eine Zumutung! So etwas verzeiht man nur dem Genie, glücklicherweise habe ich es hier mit einem solchen zu tun. Also los, weiter geht’s! … Nur noch sechzig Seiten! … Neunundfünfzig! …
Um der Titel willen lesen
Ich frage mich, ob ich nicht noch einen Grund fürs Lesen gefunden habe: das Bedürfnis, sich selbst zu widersprechen. Wenn ich einen Autor nicht mag, nehme ich ihn mir ein zweites Mal vor. Komm schon, die Schuld liegt bei dir, vielleicht ist er ja doch sehr gut! Wenn ich herausfinde, dass ich mich tatsächlich getäuscht habe, bin ich begeistert. Ich habe ein Vorurteil abgelegt.
Bei Marguerite Duras hätte ich mich damit zufriedengeben können, dass sie mir auf die Nerven geht. Ich hätte nur die Titel lesen sollen. Sie sind exzellent. Les Yeux bleus cheveux noirs (dt. Blaue Augen schwarzes Haar). Klingt wie eine moderne Fassung des wunderschönen Titels von Thomas Hardy, Blaue Augen, der sich auf Englisch allerdings besser macht: A Pair of Blue Eyes (1873). Oder auch Des journées entières dans les arbres (dt. Ganze Tage in den Bäumen). Die Titel zeigen am deutlichsten den Beckett’schen Einfluss auf ihr Werk. La Pute de la côte normande (dt. etwa: Die Hure von der normannischen Küste). Als Feindin der Wohlanständigkeit spricht sie Dinge gern unverblümt aus. Alle ernstzunehmenden Schriftsteller, diese Flegel, beschreiben Dinge, von denen sich das Establishment für den eigenen Seelenfrieden wünschen würde, sie blieben unausgesprochen. Dix heures et demie du soir en été (dt. Im Sommer abends um halb elf). Könnte auch ein Françoise-Sagan-Titel sein. (Bei dem Vergleich knirschen Duras-Fans mit dem Gebiss.) Hier zeigt sich, dass ein Titel ohne Autorenname seine Bedeutung nicht voll entfalten kann. Gibt es das eigentlich in der Literatur, einen Titel ohne Autor? Mit anderen Worten Titel, deren Autoren anonym geblieben sind? Die gibt es allerdings, und wir hören nie auf nach den Autoren zu suchen. Ganz Frankreich fragte sich jahrzehntelang, wer die Geschichte der O geschrieben hatte, diesen erotischen Roman aus dem Jahr 1954. Als bekannt wurde, dass ihn Dominique Aury verfasst hatte, eine Übersetzerin und Verlagsangestellte, verlor das Buch schlagartig an Strahlkraft. Bis dahin hatten Vermutungen kursiert, der Autor sei dieser oder jener bekannte Schriftsteller. Die Nähe zu Jean Paulhan, ein berühmter Zeitschriftenherausgeber und Verleger, der das Vorwort verfasst hatte, machte den Roman noch reizvoller, weil man zwischen den Zeilen nach Hinweisen auf seine Autorschaft suchte – und diese natürlich auch zu finden glaubte. Wer sucht, der findet, was er will. Zwischen den Zeilen liegt ein wunderbarer, magischer Raum, welcher Lesern, die des Denkens überdrüssig sind, ermöglicht, was sie eigentlich wollen: sich überzeugen lassen.
Ein Titel erlangt seine vollständige Bedeutung erst in Verbindung mit dem Namen des Autors. Im Sommer abends um halb elf könnte nicht nur ein bürgerlicher Roman sein, der in Théoule spielt, sondern genauso gut eine englische Kriminalkomödie oder der innere Monolog eines russischen Mystikers kurz vor seinem Selbstmord, kurzum, ein Titel für sich allein will gar nichts heißen. Marguerite Duras, Im Sommer abends um halb elf hingegen, bitteschön, das sagt etwas aus. Bücher werden von Menschen geschrieben, und nur Leute, die in ihrem Leben schon manch eine Schweinerei begangen haben oder schlichtweg an Überheblichkeit leiden, behaupten: »Meine Biographie ist meine Bibliographie.« Nur Dreckskerle verstecken sich hinter dem Ästhetizismus. Das ist auch der Grund, warum wir in einem Schriftsteller, wenn es gut läuft zwischen uns und seinem Buch, einen Freund finden, ja wirklich, einen richtigen Freund. Der Autor hat Fehler. Wie ein Freund. Man mag ihn, und man ärgert sich über ihn. Wie über einen Freund. Habe ich, der Leser, etwa keine Fehler? Würde sich der Autor nicht auch über mich ärgern, wenn wir uns begegneten?
So ein Schriftsteller ist eine praktische Sache, weil man ihm Fehler anhängen kann. Womit ich nicht sagen will, dass Schriftsteller keine Verantwortung tragen, welch eine erbärmliche moralische Haltung, welch eine erbärmliche literarische Haltung wäre das. Wenn wir jede Verantwortung ablehnen, ist unsere Literatur nichts als leeres Geschnatter.
Lesen, um nicht mehr Königin von England zu sein
Auf einem Spaziergang rund um ihr Schloss bleibt Königin Elisabeth II. vor einem Bibliotheksbus stehen. Hocherfreut leiht ihr der Bibliothekar ein Buch, das sie auf gut Glück herausgegriffen hat, den Roman einer Autorin, von der sie in ihrer Jugend gehört hatte. Doch das Werk von Ivy Compton-Burnett, einer mondänen Schriftstellerin der 1930er Jahre, langweilt die Königin. Peu à peu landet sie bei Proust, den sie sich, wenn sie offiziellen Defilees beiwohnen muss, auf den Schoß legt und liest. Ihre Entourage macht sich Sorgen. Ist es Alzheimer? Und überhaupt ist ihr Verhalten nicht politisch korrekt: Lesen schließt aus. Am Bibliotheksbus begegnet die Königin einem ihrer Köche. Weil der sie so gut berät, verleiht sie ihm einen hohen Rang. Doch der eifersüchtige Berater des Premierministers will den früheren Koch loswerden und schickt ihn zum Studium an eine ferne Universität, wo die Königin ihm später wieder begegnet. Als sie den Schachzug durchschaut, wirft sie den Berater des Premierministers raus. Bei einer Feier zu ihrem 80. Geburtstag verkündet sie ihren Ministern, sie werde ein Buch schreiben. Ein Buch … Ah ja, Erinnerungen an die Kindheit, den Krieg … Nein, nein, antwortet die Königin; man habe da schon eher an etwas Literarisches gedacht. Ma’am, die einzigartige Stellung, die Sie bekleiden, erlaubt es Ihnen nicht, und auch Ihr Onkel, der Herzog von Windsor, konnte Eines Königs Geschichte nur schreiben, weil er vorher abgedankt hatte. Antwort der Königin und letzter Satz des Buches: »Was glauben Sie denn, warum Sie alle hier sind?«
Die souveräne Leserin von Alan Bennett (The Uncommon Reader, 2007) präsentiert sich als Fabel über das Lesen und seine subversive Kraft. Doch in Wirklichkeit ist es ein Buch über Literatur. Als der Premierminister der Queen antwortet, sie stehe über der Literatur, erwidert die Queen: »Wer kann denn über der Literatur stehen?« – eine Frage, die natürlich keine Königin der Welt jemals gestellt hat.
Lesen und Macht
Die einzige Frage, die man sich im Hinblick auf einen Chef stellen sollte, lautet: Würde er die Bibliothek von Alexandria anzünden? Erscheint einem dieser Gedanke nicht plausibel, ist er gutmütig, und es besteht kein Grund zur Sorge. Andernfalls haftet ihm wohl etwas Vulgäres an. An Kalif Omar, den Schwiegersohn von Mohammed, erinnern wir uns, weil er mit der Vulgarität eines Fanatikers die endgültige Zerstörung dieser Bibliothek angeordnet hat (642, Eroberung Ägyptens), der wertvollsten Sammlung der Antike, deren Manuskripte für immer verloren sind. Der Zynismus von Tyrannen aus gutem Hause kann genauso zerstörerisch sein wie der Glaube, wenn er von dahergelaufenen Ehrgeizlingen instrumentalisiert wird. Solche plötzlich an die Macht gekommenen Menschen sind häufig konservativ, weshalb sich manchmal ausgerechnet die schlimmsten Diktatoren als Förderer der Lektüre entpuppten. In der Sowjetunion waren Bücher günstig, in den Schulen wurde zaristische Literatur gelehrt – wenn auch nur, um zu beweisen, dass der Realsozialismus über die Feudalherrschaft gesiegt hatte –, und die Manuskripte der Klassiker wurden sorgsam verwahrt. Der aus Büchern geborene Bolschewismus stellte das Buch unter seinen Schutz. Marx hat Puschkin gerettet. Beide Mitglieder der schreibenden Zunft! Ich denke nicht ohne Melancholie an den Sommer 1988 zurück, den letzten fröhlichen Sommer für unsereins, die Elite der Partei, als wir auf der Terrasse unserer Datscha am Ufer des Schwarzen Meeres noch einmal Der Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft von Josef Stalin lasen (das meiner Meinung nach besser ist als Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR).
Man möge lieber meine Bücher verbrennen als Menschen.
Lücken lesen
Einer der ersten Erwachsenenromane, die ich las, war das Satyricon von Petronius (Leser: zweite Hälfte 20. Jahrhundert; Autor: Mitte 1. Jahrhundert), und ich habe mich sehr gefreut, als ich erfuhr, dass dieser Text als erster abendländischer Roman gilt. Es ist ein munterer Roman. Spitzzüngig. Und fragmentarisch. Man erklärte mir, von antiken Büchern seien nur Abschriften erhalten, die in mittelalterlichen Klöstern angefertigt worden seien. Den Mönchen ist es hoch anzurechnen, dass sie mit ihrer naiven Liebe zu allem Geistigen ein Leben lang Bücher abschrieben, deren Religion ihrem Glauben widersprach, Bücher, die manchmal äußerst gewagte Dinge enthielten. Schlug vielleicht schon die Stunde zum Vespergottesdienst, weshalb der Bruder, der sich um Petronius kümmerte, mit geraffter Soutane, die Abschrift unter dem Arm, zum Refektorium eilte? Sind ihm dann in seiner Hast einige Blätter entglitten, die vom Wind ergriffen und auf einen Haufen Papier getragen wurden, der für die Verpackung von Likörflaschen bereitlag? Oder wurden die alten Papierbogen von Insektenflügeln entführt? Jedenfalls liegt uns das Satyricon nur unvollständig vor. Die Lektüre seiner Lücken hat etwas Faszinierendes. Weniger als das, was geblieben ist, und nur existent aufgrund dessen, was geblieben ist. Was hat diese Lücke einst gefüllt?, fragt man sich jedes Mal und wird noch mehr zum Sherlock Holmes, als man es ohnehin bei jeder Lektüre ist. Angeblich ist das Satyricon erst im Laufe seiner Reise durch die Zeit zum Lückentext geworden. Nun gut. Wenn ich nun aber behaupte, es liege nicht an der Zeit, sondern an Petronius’ Genie? Dass er seine Lücken selbst entworfen hat? Die Herablassung, mit der die Gegenwart der Vergangenheit begegnet, ist manchmal geradezu lachhaft. Schon mal gehört, dass es auch früher intelligente Leute gab? Also habe ich mir gesagt: Schreiben wir einen Lücken-Roman. Gesagt, getan: Nos vies hâtives hat sich zugegebenermaßen nicht gerade blendend verkauft.
Der Leser schafft sich wohl seine eigenen Lücken, indem er Seiten überspringt.
Lesen, um zu masturbieren
In einem frommen Buch, einem Erbstück meiner Familie, habe ich die Hölle gesehen. Eine gewaltige Hölle, erhaben und wimmelnd von unzähligen Gestalten. In der Mitte dieser Radierung saß der Teufel auf einem Thron. Ganz ruhig saß er da. Das machte ihn umso bedrohlicher. Zu seinen Füßen waren die sieben Höhlen, eine für jede Todsünde – symbolisiert durch eine Schildkröte, einen Spiegel etc. –, in denen die Seelen gefoltert wurden. Ich war noch ein Kind, und ich war schockiert. Immer wieder griff ich zu dem Buch. Die Hölle ist verführerisch. Man kann ihr diesen Vorwurf ruhig machen, schließlich gibt es sie ja gar nicht.
Es ist ärgerlich, dass unserem Verstand in jungen Jahren die Angst zur Seite steht.
Im Erwachsenenalter trat an diese Stelle die Sexualität, allerdings nur heimlich. Natürlich wusste ich nicht, dass die Nationalbibliothek ihre erotischen Bücher hinter einer besonderen Signatur verbarg: »Enfer«, zu Deutsch: Hölle. Was im Übrigen gar nicht mehr nötig war: Pornographie war inzwischen legal. In der zehnten Klasse kursierten unter unseren Pulten Taschenbuchausgaben des Marquis de Sade, die schwarzen Einbände vom vielen Lesen nach oben gewölbt wie gekochte Artischocken. Welch eine Leidenschaft für die Literatur! Die wahre Funktion dieses Schriftstellers offenbarte sich mir bald, aber ich fand auch, dass er geheimnisvoll schrieb. Ich täuschte mich in jeder Hinsicht: Er schrieb schlecht, im mittelmäßigen Stil seiner Zeit, und doch war seine Funktion komplexer als die einer Inspiration zum Masturbieren. Er macht den Sex zu einem revolutionären Akt, und das passte gut zu meiner pedantischen Epoche, in der hysterische Professoren erklärten, alles sei politisch. Die Fröhlichkeit des Sex, seine essentielle und selbstvergessene Leichtigkeit wurden auch damals geleugnet. Der Kampf gegen die Heuchelei hat zu meiner Zeit das heuchlerischste aller Mittel gewählt und behauptet, keineswegs um der Lust willen die Türen der Hölle aufzustoßen.
Aber immerhin hat man sie aufgestoßen, und es schadet nicht, Schriftsteller der Vergangenheit neu zu interpretieren und in ihnen einen neuen Nutzen für uns zu finden. Das frischt sie auf. Manch einem arrivierten Schriftsteller hat die posthume Veröffentlichung freizügiger Briefwechsel schon neue Sympathien eingebracht, auch wenn er es sich dadurch mit seiner bürgerlichen Leserschaft verscherzt haben mag. Diese bürgerliche Klientel findet immer einen respektablen Ersatz und hätte ihn ohnehin früher oder später gnadenlos aus ihrem Gedächtnis gestrichen.
Mit einer erotischen Deutung der Gedichte von Emily Dickinson, ausgehend von dem Vers I taste a liquor never brewed, hätte ich einer routiniert heruntergeschnurrten, spiritualistischen Interpretation etwas Neues entgegengesetzt. Ich hätte vielleicht nicht Recht, aber ich würde immerhin dafür sorgen, dass man sich wieder für Dickinson interessiert.
Ähnlich verhält es sich mit Theaterinszenierungen, über die alte Menschen aller Generationen, die sich für diese Kunst interessieren und sich die Eintrittskarten leisten können, immer schimpfen. Inszenierungen dieser Art sind wie eine frische, kräftige Brise für die starren Klassiker, zu denen alle namhaften Theaterstücke nach einigen Jahrzehnten verkommen. Da flattern die Spitzenkleider, da purzeln die Schleierhütchen, und der muffige Geruch verzieht sich! Und selbst wenn am Ende nur eine Wachsfigur mit entblößtem Hintern zurückbleibt, hat man wenigstens etwas anderes getan, als bloß eine Aufführung wiederzukäuen.
Schriftsteller werden umgelenkt wie Flüsse. Das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass sich die Nachwelt zusammensetzt aus Zeitgenossen, die es langweilt, immer wieder dasselbe zu hören, und die sich deshalb neuen Büchern zuwenden, werde ich persönlich versuchen, meine Nachwelt mit einigen posthumen Werken zu überraschen. Mit ihnen werde ich meine früheren Leser enttäuschen; die künftigen Leser aber werden vielleicht aus Entdeckerdrang und Freude am Widerspruch sagen: »Er war nicht so, wie ihr immer behauptet habt. Wir sind die einzigen, die ihn verstanden haben.« Das wird ungerecht sein, aber wenn Sie glauben, die Nachwelt sei gerecht, dann rate ich Ihnen, sich sofort das Leben zu nehmen.
Literatur entzieht sich der Moral. Alte Kamelle, schon gehört, langweilig. Aber so einfach ist das nicht. Im Jahr 2007, beim zweiten Wahlgang zur französischen Präsidentschaftswahl, hatten wir zwei Kandidaten, die für Werte einstanden. Bei den Parlamentswahlen 2010 in Ungarn, Holland und dem belgischen Flandern haben die reaktionärsten Parteien gewonnen. Sie haben ein närrisches Programm, eine närrische Kampagne, ein närrisches Benehmen, und selbst wenn sie verlieren, hören sie nicht auf, närrisch zu sein. In der Slowakei, wo die Nationalisten ihre ehrgeizigen Ziele nicht erreicht haben, erklärte ihr enttäuschter Chef: »Die Homosexuellen und die Ungarn werden den Staat beherrschen.« Narren können das Fürchten lehren. In Amerika hat die republikanische Partei eine Narrentruppe aufgestellt, die auf Stimmenfang gehen soll – in der Hefe des Volkes, wie es bei Saint-Simon heißt (in seinem Fall eine kleinbürgerliche Hefe), und zwar mit Hilfe von rassistischen, bigotten und außerordentlich resoluten Erklärungen. Möglicherweise wird es Sarah Palin wie Frankensteins Kreatur gelingen, ihren Schöpfern zu entkommen und sich selbst zur Präsidentschaftswahl aufzustellen. Dann wird uns das Lachen vergehen. Wir Repräsentanten der zivilisierten Welt wissen, dass uns die Narren zu Sterblichen machen. Man muss sie sofort erledigen.
»Erst als seine Macht unüberwindlich geworden war und er unmittelbar auf den Umsturz hinarbeitete, merkten sie zu spät, dass jegliches Unternehmen, mag es im Anfang noch so unbedeutend scheinen, durch Ausdauer zu unwiderstehlicher Macht anwachsen kann, wenn man es unbeachtet lässt.«
Plutarch, Römische Heldenleben. Cäsar
Ein Wind der 1930er Jahre weht um die Welt. Er riecht nicht gut. Wären diese Vorkämpfer für sogenannte Werte imstande, bei einem Buch die masturbatorische Funktion von der literarischen zu unterscheiden? Doch wir sollten uns vor allzu schnellen Vergleichen hüten, sollten Gegenwart und Vergangenheit nicht leichtfertig in einen Topf werfen, denn die wirkliche Gefahr ist immer ein bisschen anders und droht vielleicht von unerwarteter Seite. In unserer Welt, in der sich Rückschritt und Unanständigkeit verquicken und zugleich eine zügellose Lust am Verbot herrscht, schwant mir wie dem Abbé Blanès in Stendhals Kartause von Parma, dass seltsame Stürme heraufziehen.
Die gesellschaftliche Heuchelei in puncto Sexualität ist so groß, dass es tatsächlich noch Menschen gibt, die sich als sexuelle Stimulanzien Bücher kaufen, die dafür gar nicht gemacht sind. Das sexuelle Leben der Catherine M, in dem Catherine Millet versucht hat, aus ihren Erfahrungen im Partnertausch Literatur zu machen, hat sich bestimmt nur deshalb hunderttausendfach verkauft, weil es als Veröffentlichung eines respektablen Verlags gekauft werden konnte, ohne dass sich die triebgesteuerten Irren verschämt in Sex-Shops stehlen mussten. Die Enttäuschungen dürften größer gewesen sein als die Erektionen.
Das Problem gewisser Romanautoren, die anfangen, über Sex zu schreiben, liegt darin, dass sie beim Schreiben von ihren Obsessionen beherrscht werden. Da liebt jemand sehr junge Mädchen, na schön, aber es überkommt ihn in einer solchen Weise, dass er sich nicht bremsen kann. Auf diese Weise verrät er eine seiner Aufgaben – Emotionen eine Form zu geben, anstatt sich die Form von den Emotionen diktieren zu lassen. Sein Buch trägt am Ende nur zur Befriedigung einer bösen Begierde bei. Das weiß der Leser und verachtet dieses Buch, das keine ästhetische, sondern eine rein pragmatische Funktion erfüllt.
Ein befreundeter Schriftsteller fragte sich, warum es ihm eigentlich nie gelungen ist, ein literarisches Buch zu schreiben, das auch pornographische Passagen enthält. Die Pornographie ist ohne jeden Zweifel zweckgebunden, während die Literatur keinen Zweck erfüllt. Aus diesem Grund lassen sich beide nicht miteinander verbinden, man kann mit Pornographie keine Literatur machen. Pornographie hat eine Funktion, Literatur ist ein Zustand. Ein Symptom dieser unmöglichen Verquickung ist die begriffliche Vielfalt: Wie kann es sein, dass Sex die einzige menschliche Tätigkeit und dass die Geschlechtsorgane die einzigen Teile des menschlichen Körpers sind, für die ein so umfangreicher Wortschatz zur Verfügung steht? Es gibt nur ein Wort für »Hals« oder»Ohr«, während ganze Wortfelder bereitstehen, sobald über die Sexualität gesprochen wird. Je nachdem, ob man »Vagina«, »Muschi« oder »Fotze« sagt, wählt man ein medizinisches, ein lockeres oder ein vulgäres Feld. Es scheint fast unmöglich, auf schlichte Weise über Sexualität zu sprechen. Ich frage mich, ob nicht Schamgefühle die Ursache sind.
Wie war er wohl, der Mann, der in der Nationalbibliothek auf die Idee verfallen ist, die Abteilung für erotische Bücher per Signatur als Hölle zu bezeichnen? Ein Humorist oder ein Überzeugungstäter? Ein Buckliger mit Hängebacken, der jeden Abend nach Hause ging, um vor entliehenen Büchern verschämt zu masturbieren, oder ein junger Spaßvogel, der sich bei einer Besprechung über einen prüden Beamten mokieren wollte? Ein schönes Romansujet. Der Wortschatz der Nationen ist der Roman der Welt.

Von der erwachsenen Emily Dickinson ist nur ein einziges Porträt überliefert. Sie hat Glück. Seit hundertfünfzig Jahren wird es unendlich oft abgedruckt. Es verankert ihr Bild in den Köpfen eines überfrachteten Publikums. Auch ein Teil des Ruhms von Rimbaud rührt von seinem Foto her, jung und zerzaust, die blau-weißen Augen eisern auf eine Zukunft gerichtet, die gut daran täte, nicht mehr allzu lange auf sich warten zu lassen, bereit, genau die Institutionen zu zerschlagen, die sein Bildnis vereinnahmen werden, um sein Denken besser totschweigen zu können.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+31
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе